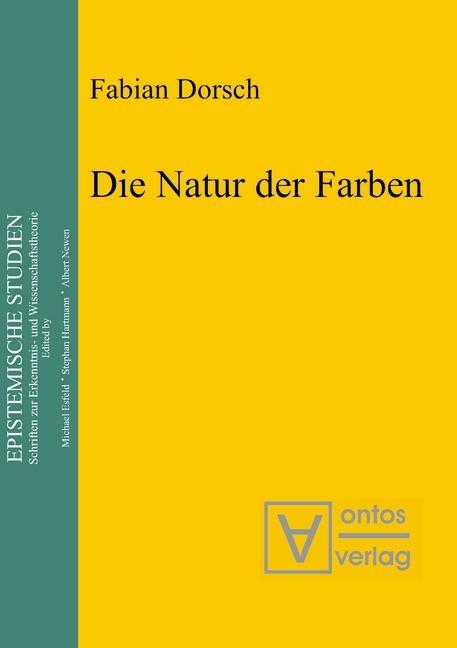
Sofort lieferbar (Download)
Farben sind für uns sowohl objektive, als auch phänomenale Eigenschaften. In seinem Buch argumentiert Fabian Dorsch, daß keine ontologische Theorie der Farben diesen beiden Seiten unseres Farbbegriffes gerecht werden kann. Stattdessen sollten wir akzeptieren, daß letzterer sich auf zwei verschiedene Arten von Eigenschaften bezieht: die repräsentierten Reflektanzeigenschaften von Gegenständen und die qualitativen Eigenschaften unserer Farbwahrnehmungen, die als sinnliche Gegebenheitsweisen ersterer fungieren. Die Natur der Farben gibt einen detaillierten Überblick über die zeitgenössischen philosophischen und naturwissenschaftlichen Theorien der Farben und bietet sich aufgrund seines systematischen und umfassenden Charakters auch als ein seminar- oder vorlesungsbegleitendes Textbuch an.
Inhaltsverzeichnis
1;1. Einleitung;11 1.1;1.1. Das Hauptproblem ontologischer Farbtheorien;11 1.2;1.2. Die empiristisch geprägte Tradition;20 1.3;1.3. Der Übergang zur analytischen Philosophie;27 2;2. Die Zwei Seiten der Farben;41 2.1;2.1. Die Analyse der Natur der Farben;41 2.2;2.2. Der Minimalkonsens;47 2.2.1;2.2.1. Präsentation und Introspektierbarkeit;47 2.2.2;2.2.2. Farben als präsentierte Eigenschaften;48 2.2.3;2.2.3. Introspektive Individuation von Farbwahrnehmungen;53 2.3;2.3. Die Intuitive Farbkonzeption;56 2.3.1;2.3.1. Allgemeine Merkmale wahrnehmbare Eigenschaften;59 2.3.2;2.3.2. Spezifische Merkmale der Farben;63 2.4;2.4. Theoretische Grundlagen;76 2.4.1;2.4.1. Gehalt;76 2.4.2;2.4.2. Referentialität und Räumlichkeit;84 2.4.3;2.4.3. Qualia;89 2.5;2.5. Die zwei Aspekte der Intuitiven Farbkonzeption;93 2.5.1;2.5.1. Der repräsentationale Aspekt;95 2.5.2;2.5.2. Der phänomenale Aspekt;98 2.5.3;2.5.3. Introspektivität des Gehaltes;103 2.6;2.6. Die Individuierung der Farben;106 2.6.1;2.6.1. Die Aktualitätsthese und die Notwendigkeitsthese;106 2.6.2;2.6.2. Wahrheitsanspruch und Transparenz;112 2.6.3;2.6.3. Farben als repräsentierte Farben;114 2.6.4;2.6.4. Farben als phänomenale Farben;119 2.6.5;2.6.5. Die Herleitung des zentralen Bikonditionals;121 2.6.6;2.6.6. Die Aktualitäts- und Notwendigkeitsthesen unter Normalbedingungen;125 3;3. Eine Systematik der Farbtheorien;127 3.1;3.1. Subjektivismus und Objektivismus;127 3.1.1;3.1.1. Subjektrelativität und Subjektabhängigkeit;127 3.1.2;3.1.2. Der Euthypron-Kontrast;129 3.1.3;3.1.3. Metaphysische Notwendigkeit als Kriterium;133 3.1.4;3.1.4. Epistemische Notwendigkeit als Kriterium;144 3.1.5;3.1.5. Die systematische Klassifikation der Theorien;148 3.2;3.2. Transparenz;150 3.2.1;3.2.1. Die Objektivitätsthese und die Aktualitätsthese;151 3.2.2;3.2.2. Die Transparenzthese und die Offensichtlichkeitsthese;154 3.2.3;3.2.3. Zusammenfassung der Debatten;168 3.3;3.3. Normalbedingungen;173 3.3.1;3.3.1. Normalbedingungen der Repräsentation von Refl
ektanzeigenschaften;174 3.3.2;3.3.2. Normalbedingungen und Farbtheorien;183 3.3.3;3.3.3. Die Unbestimmtheit der Wahrnehmung;184 3.3.4;3.3.4. Probleme der externen Normalbedingungen;191 4;4. Objektivistische Theorien der Farben;195 4.1;4.1. Der Farbphysikalismus im allgemeinen;196 4.1.1;4.1.1. Die Definition des Farbphysikalismus;197 4.1.2;4.1.2. Die Individuation der P-Eigenschaften;201 4.1.3;4.1.3. Formen des Farbphysikalismus;204 4.2;4.2. Der Starke Physikalismus;208 4.2.1;4.2.1. Farben als Reflektanzprofile;209 4.2.2;4.2.2. Informationalismus;226 4.3;4.3. Der Schwache Physikalismus;229 4.3.1;4.3.1. Dispositionen;231 4.3.2;4.3.2. Farben als Reflektanztypen;234 4.3.3;4.3.3. Farben als Disjunktionen;238 4.3.4;4.3.4. Farben als subjektrelative Dispositionen;245 4.3.5;4.3.5. Epiphänomenalismus und Erklärungskraft;251 4.3.6;4.3.6. Farbmultiplizität und Naturgesetzmäßigkeiten;253 4.4;4.4. Starker und Schwacher Physikalismus im Vergleich;256 4.5;4.5. Argumente gegen den Aktualitätsobjektivismus;262 4.5.1;4.5.1. Mit der Farbigkeit von Entitäten in der Welt verbundeneEinwände;262 4.5.2;4.5.2. Mit der Intuitiven Farbkonzeption verbundene Einwände;268 4.6;4.6. Argumente gegen den Notwendigkeitsobjektivis - mus;279 4.6.1;4.6.1. Argumente gegen die Notwendigkeitsthese an sich;280 4.6.2;4.6.2. Probleme mit der Erklärung der Phänomenalität;290 4.7;4.7. Der Primitivismus;301 4.7.1;4.7.1. Der dualistische Primitivismus;302 4.7.2;4.7.2. Der physikalistische Primitivismus;304 5;5. Subjektivistische Theorien der Farben;315 5.1;5.1. Die Repräsentierbarkeit von subjektiven Eigenschaften;318 5.2;5.2. Der relationalistische Subjektivismus;334 5.2.1;5.2.1. Der subjektivistische Dispositionalismus;335 5.2.2;5.2.2. Unplausibilität des subjektivistischen Dispositionalismus;337 5.2.3;5.2.3. Weitere mögliche Gegenargumente;347 5.3;5.3. Projektivismus;350 5.3.1;5.3.1. Argumente gegen den Projektivismus im allgemeinen;357 5.3.2;5.3.2. Der Wörtliche Projektivismus;360 5.3.3;5.3.3. Der Bildliche P
rojektivismus;369 6;6. Das resultierende Bild der Farben;377 6.1;6.1. Unplausible Theorien der Farben;377 6.2;6.2. Aufspaltung der Intuitiven Farbkonzeption;381 6.3;6.3. Plausible Theorien der Farben;382 6.4;6.4. Farbqualia als phänomenale Gegebenheitsweisenvon Farben;385 7;Appendix A: Dispositionen;393 7.1;A.1. Eine kategoriale Theorie der Dispositionen;393 7.2;A.2. Weite Dispositionen;400 7.3;A.3. Enge Dispositionen;410 7.4;A.4. Fazit;412 8;Appendix B: Die Wissenschaft der Farben;415 8.1;B.1. Die Methode der Wissenschaft der Farben;416 8.2;B.2. Die Resultate der Wissenschaft der Farben;422 8.2.1;B.2.1. Das visuelle System;423 8.2.2;B.2.2. Die Wechselwirkungen von physikalischen Objektenund Lichtwellen;430 8.2.3;B.2.3. Farbwahrnehmende Subjekte;434 8.3;B.3. Das Farbensehen;439 8.3.1;B.3.1. Eine erste These über das Farbensehen;439 8.3.2;B.3.2. Farbensehen als zweifacher Vergleichsprozeß;442 8.3.3;B.3.3. Problematische Punkte dieser Theorie;449 8.4;B.4. Die Farbkonstanz;456 8.4.1;B.4.1. Für Farbkonstanz erforderliche Lichtbedingungen;459 8.4.2;B.4.2. Für Farbkonstanz erforderliche Kontextbedingungen;464 8.4.3;B.4.3. Typen von spektralen Oberflächenreflektanzen;470 9;Nachwort;479 10;Bibliographie;481 11;Register;489
ektanzeigenschaften;174 3.3.2;3.3.2. Normalbedingungen und Farbtheorien;183 3.3.3;3.3.3. Die Unbestimmtheit der Wahrnehmung;184 3.3.4;3.3.4. Probleme der externen Normalbedingungen;191 4;4. Objektivistische Theorien der Farben;195 4.1;4.1. Der Farbphysikalismus im allgemeinen;196 4.1.1;4.1.1. Die Definition des Farbphysikalismus;197 4.1.2;4.1.2. Die Individuation der P-Eigenschaften;201 4.1.3;4.1.3. Formen des Farbphysikalismus;204 4.2;4.2. Der Starke Physikalismus;208 4.2.1;4.2.1. Farben als Reflektanzprofile;209 4.2.2;4.2.2. Informationalismus;226 4.3;4.3. Der Schwache Physikalismus;229 4.3.1;4.3.1. Dispositionen;231 4.3.2;4.3.2. Farben als Reflektanztypen;234 4.3.3;4.3.3. Farben als Disjunktionen;238 4.3.4;4.3.4. Farben als subjektrelative Dispositionen;245 4.3.5;4.3.5. Epiphänomenalismus und Erklärungskraft;251 4.3.6;4.3.6. Farbmultiplizität und Naturgesetzmäßigkeiten;253 4.4;4.4. Starker und Schwacher Physikalismus im Vergleich;256 4.5;4.5. Argumente gegen den Aktualitätsobjektivismus;262 4.5.1;4.5.1. Mit der Farbigkeit von Entitäten in der Welt verbundeneEinwände;262 4.5.2;4.5.2. Mit der Intuitiven Farbkonzeption verbundene Einwände;268 4.6;4.6. Argumente gegen den Notwendigkeitsobjektivis - mus;279 4.6.1;4.6.1. Argumente gegen die Notwendigkeitsthese an sich;280 4.6.2;4.6.2. Probleme mit der Erklärung der Phänomenalität;290 4.7;4.7. Der Primitivismus;301 4.7.1;4.7.1. Der dualistische Primitivismus;302 4.7.2;4.7.2. Der physikalistische Primitivismus;304 5;5. Subjektivistische Theorien der Farben;315 5.1;5.1. Die Repräsentierbarkeit von subjektiven Eigenschaften;318 5.2;5.2. Der relationalistische Subjektivismus;334 5.2.1;5.2.1. Der subjektivistische Dispositionalismus;335 5.2.2;5.2.2. Unplausibilität des subjektivistischen Dispositionalismus;337 5.2.3;5.2.3. Weitere mögliche Gegenargumente;347 5.3;5.3. Projektivismus;350 5.3.1;5.3.1. Argumente gegen den Projektivismus im allgemeinen;357 5.3.2;5.3.2. Der Wörtliche Projektivismus;360 5.3.3;5.3.3. Der Bildliche P
rojektivismus;369 6;6. Das resultierende Bild der Farben;377 6.1;6.1. Unplausible Theorien der Farben;377 6.2;6.2. Aufspaltung der Intuitiven Farbkonzeption;381 6.3;6.3. Plausible Theorien der Farben;382 6.4;6.4. Farbqualia als phänomenale Gegebenheitsweisenvon Farben;385 7;Appendix A: Dispositionen;393 7.1;A.1. Eine kategoriale Theorie der Dispositionen;393 7.2;A.2. Weite Dispositionen;400 7.3;A.3. Enge Dispositionen;410 7.4;A.4. Fazit;412 8;Appendix B: Die Wissenschaft der Farben;415 8.1;B.1. Die Methode der Wissenschaft der Farben;416 8.2;B.2. Die Resultate der Wissenschaft der Farben;422 8.2.1;B.2.1. Das visuelle System;423 8.2.2;B.2.2. Die Wechselwirkungen von physikalischen Objektenund Lichtwellen;430 8.2.3;B.2.3. Farbwahrnehmende Subjekte;434 8.3;B.3. Das Farbensehen;439 8.3.1;B.3.1. Eine erste These über das Farbensehen;439 8.3.2;B.3.2. Farbensehen als zweifacher Vergleichsprozeß;442 8.3.3;B.3.3. Problematische Punkte dieser Theorie;449 8.4;B.4. Die Farbkonstanz;456 8.4.1;B.4.1. Für Farbkonstanz erforderliche Lichtbedingungen;459 8.4.2;B.4.2. Für Farbkonstanz erforderliche Kontextbedingungen;464 8.4.3;B.4.3. Typen von spektralen Oberflächenreflektanzen;470 9;Nachwort;479 10;Bibliographie;481 11;Register;489
Produktdetails
Erscheinungsdatum
02. Mai 2013
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
493
Reihe
Epistemische Studien / Epistemic Studies
Autor/Autorin
Fabian Dorsch
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Produktart
EBOOK
Dateiformat
PDF
ISBN
9783110329476
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Die Natur der Farben" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.








