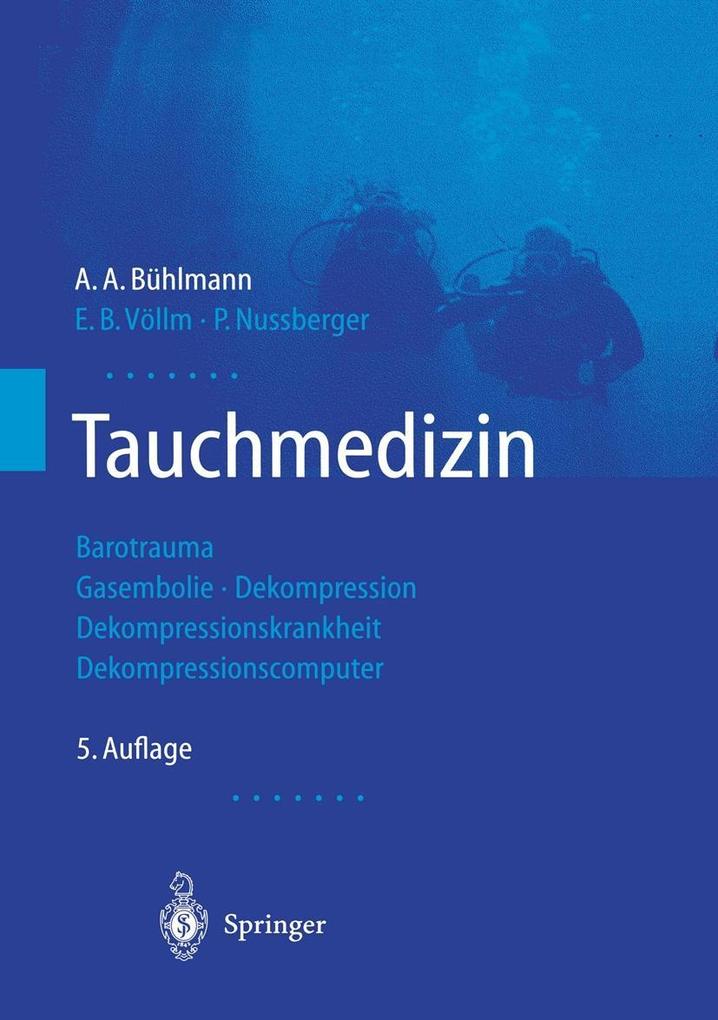Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung: Tauchmedizinische Forschung in der Schweiz. - 2 Abnorme atmosphärische Bedingungen. - 2. 1 Höhe, Hypoxie. - 2. 2 Hyperoxie und hyperbarer O2. - 2. 3 Atemwegswiderstände bei Überdruck. - 2. 4 Atmung und Kreislauf beim Tauchen, Zentralisation, Lungenödem. - 2. 5 Tiefenrausch, N2-Narkose. - 2. 6 High pressure nervous syndrome (HPNS). - 2. 7 Hypothermie und Hyperthermie. - Aktueller Wissensstand. - 3 Zwischenfälle beim Tauchen. - 3. 1 Der tödliche Tauchunfall: Ertrinken beim Sporttauchen. - 3. 2 Nichttödliche Zwischenfälle beim Tauchen. - 3. 3 Gasblasen und Gasansammlung im Gewebe bei konstantem Umgebungsdruck. - 3. 4 Gasembolie bei Senkung des Umgebungsdrucks. - 3. 5 Dekompressionskrankheit. - Aktueller Wissensstand. - 4 Behandlung des verunglückten Tauchers. - 4. 1 Notaufstieg und Nachholen der Dekompression im Wasser. - 4. 2 Erste Hilfe, Transport des verunglückten Tauchers. - 4. 3 Behandlung in der Überdruckkammer. - 4. 4 Spontanverlauf bei akuten Schädigungen des Innenohrs, des Gehirns oder des Rückenmarks. - 4. 5 Ergebnisse der Behandlung in der Überdruckkammer. - Aktueller Wissensstand. - 5 Inertgasaufnahme und -abgabe des menschlichen Körpers. - 5. 1 Physikalische und biologische Grundlagen. - 6 Symptomlos tolerierter Inertgasüberdruck im Gewebe. - 6. 1 Klinische Erfahrung und Experimente. - 6. 2 Tolerierter Inertgasüberdruck bei einem Umgebungsdruck von 1, 0 bar. - 6. 3 Tolerierter pt. N2 und pt. He bei einem Umgebungsdruck von 1, 0 bar am Ende der Dekompression. Experimente. - 6. 4 Identifikationen der Halbwertszeiten mit Geweben. - 6. 5 Lineare Beziehung zwischen Umgebungsdruck und symptomlos toleriertem Inertgasüberdruck. - 6. 6 Inertgasabgabe bei Senkung des Umgebungsdrucks. Mikrogasblasen im venösen Blut. - Aktueller Wissensstand. - 7 Das Rechenmodell ZH-L16A. - 7. 1 Empirische Grenzenfür den tolerierten Inertgasüberdruck. - 7. 2 Mathematische Ableitung des tolerierten N2-Überdrucks von den N2-Halbwertszeiten. - 7. 3 Toleranzgrenzen für Helium. - 8 Theoretische Toleranzgrenzen und experimentelle Ergebnisse. - 8. 1 Retrospektive Studien und prospektive reale Tauchgänge. - 8. 2 Tolerierter pt. N2 am Ende der Dekompression in Prozent der ZH-L16A-Grenzen. Ersttauchgänge mit Luft. - 8. 3 Tolerierter pt. He am Ende der Dekompression in Prozent der ZH-L16A-Grenzen. Ersttauchgänge. - 8. 4 Tolerierter pt. N2 in Abhängigkeit von unterschiedlichen Werten für den Umgebungsdruck. Ersttauchgänge mit Luft. - 8. 5 Tolerierter pt. He in Abhängigkeit vom Umgebungsdruck. - 8. 6 Sättigungstauchgänge mit N2 und mit Helium. - 8. 7 Wiederholte Tauchgänge mit Luft. - 8. 8 Dekompressionen in die Höhe nach einem Tauchgang. Fliegen nach dem Tauchen. - 8. 9 Erfahrungen bei täglich mehrstündigen Tunnelarbeiten. - 8. 10 ZH-L16-Modifikationen für die praktische Anwendung. - Aktueller Wissensstand. - 9 Dekompressionstabellen. - 9. 1 Entwicklung der Tabellen seit Haidane 1908. - 9. 2 Regeln für die Berechnung der Tabellen ZH-86. - 9. 3 Vergleich von Dekompressionsprofilen der Tabellen ZH-86 mit simulierten Tauchgängen. - 9. 4 Wiederholte Tauchgänge. - 9. 5 Fliegen nach dem Tauchen. - Aktueller Wissensstand. - 10 Das adaptive Rechenmodell ZH-L8 ADT (E. Völlm). - 10. 1 Adaptationen des Kreislaufs und deren Berücksichtigung im Rechenmodell. - 10. 2 Mikrogasblasenbildung und deren Berücksichtigung im Rechenmodell. - 10. 3 Praktische Auswirkungen des Rechenmodells ZH-L8 ADT beim Tauchen. - 10. 4 Die Möglichkeiten des adaptiven Rechenmodells. - 11 Dekompressionscomputer (E. Völlm). - 11. 1 Vorteile und Gefahren. - 11. 2 Struktur eines Tauchcomputers. - 11. 3 Hardware. - 11. 4 Software. - 11. 5 Berechnungsschritte desTauchcomputers. - 11. 6 Sicherheit. - 11. 7 Ein Blick in die Zukunft. - 12 Individuelle Dekompression. - Anhang: Luftdekompressionstabellen für 0 700 m ü. NN, 701 2500 m ü. NN und 2501 4500 m ü. NN sowie Tabelle für die Zeitzuschläge bei Wiederholungstauchgängen. - Nullzeiten bei Atmung von 50% O2 und 50% N2 ( Nitrox ) für 0 700 m ü. NN. - Wichtige Internetadressen. - Literatur.