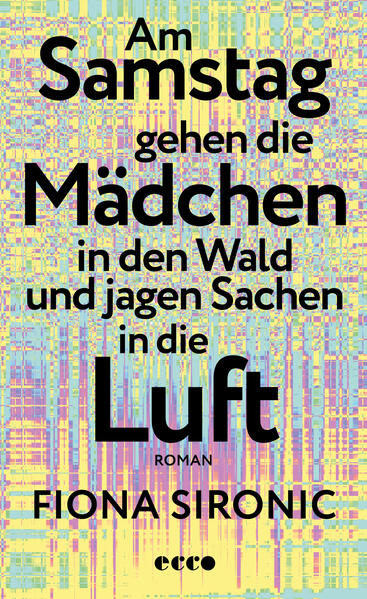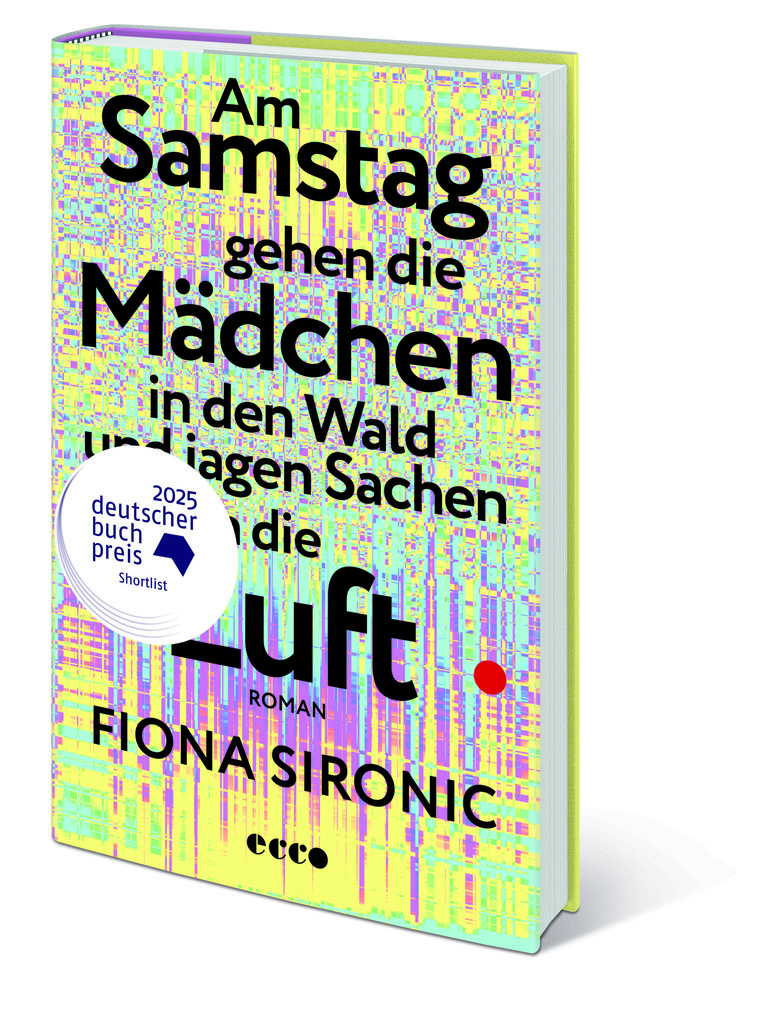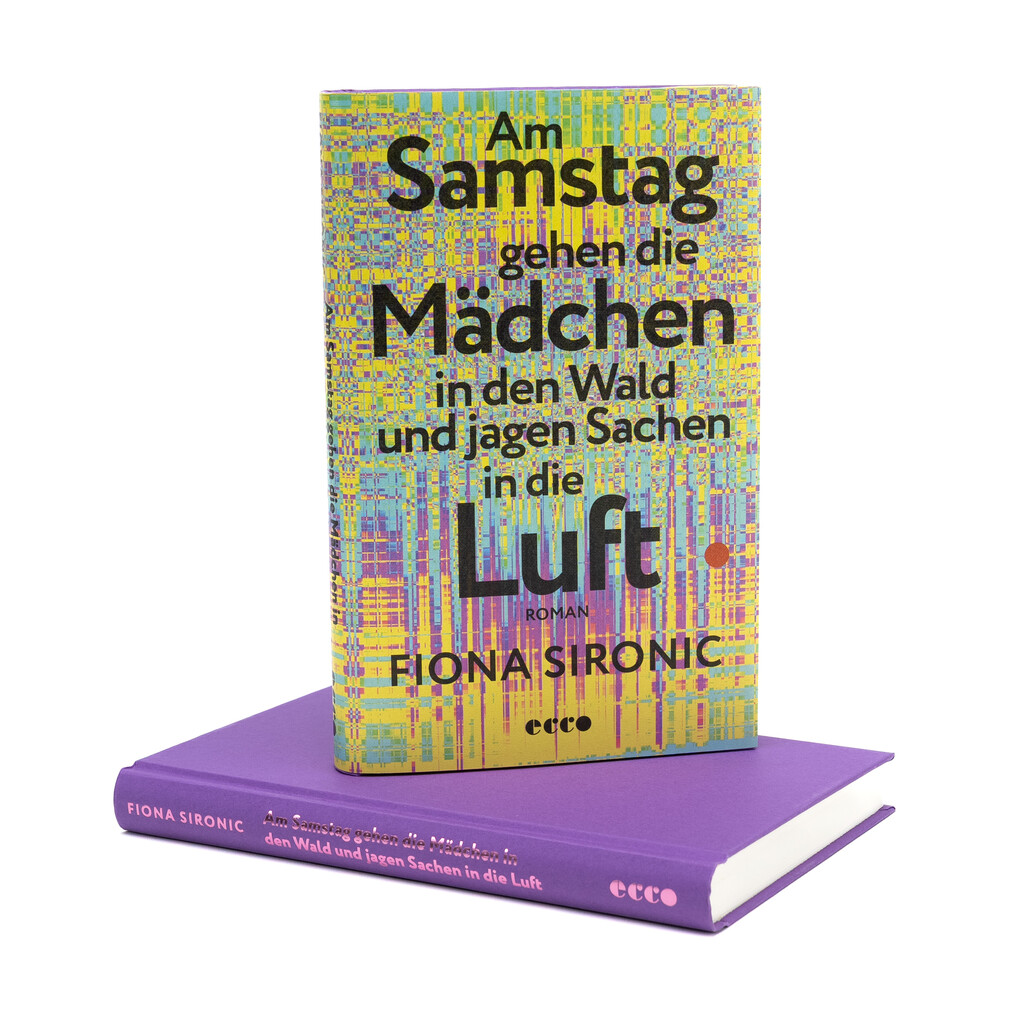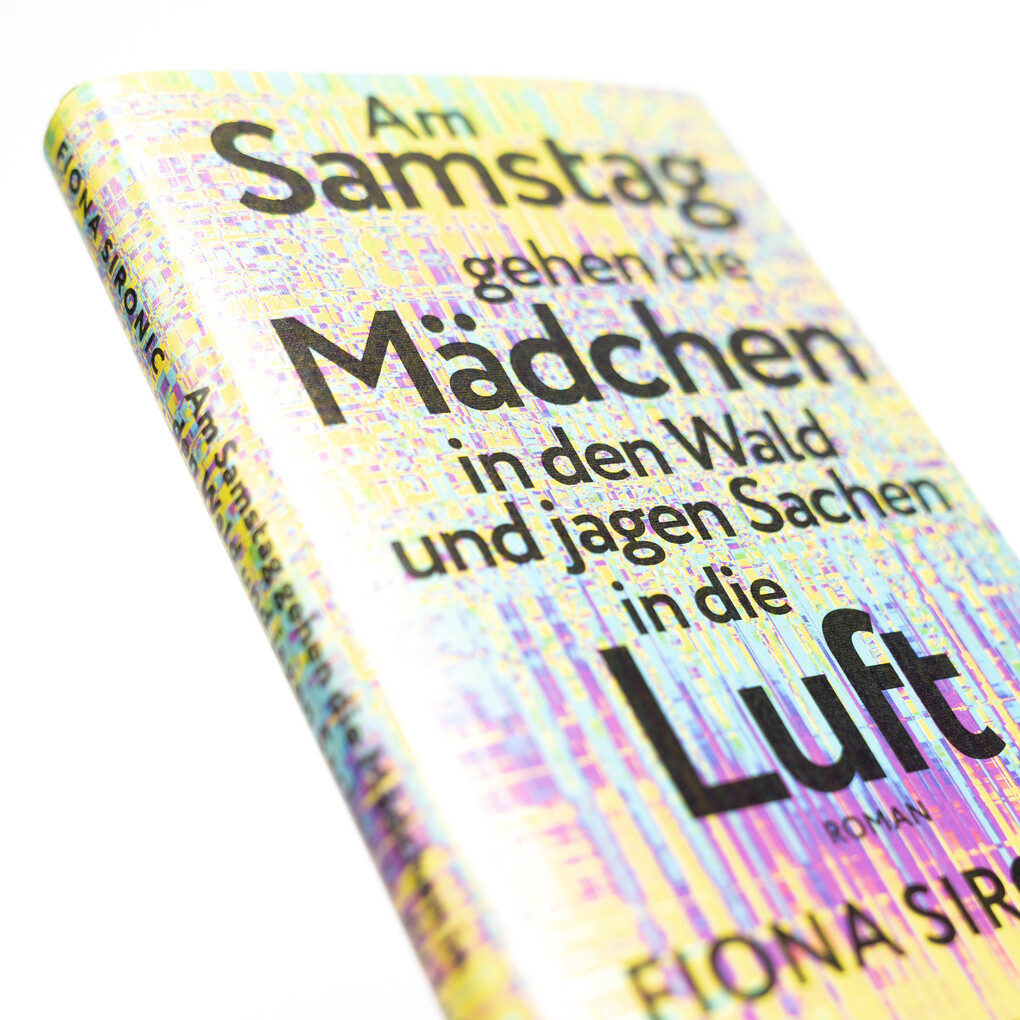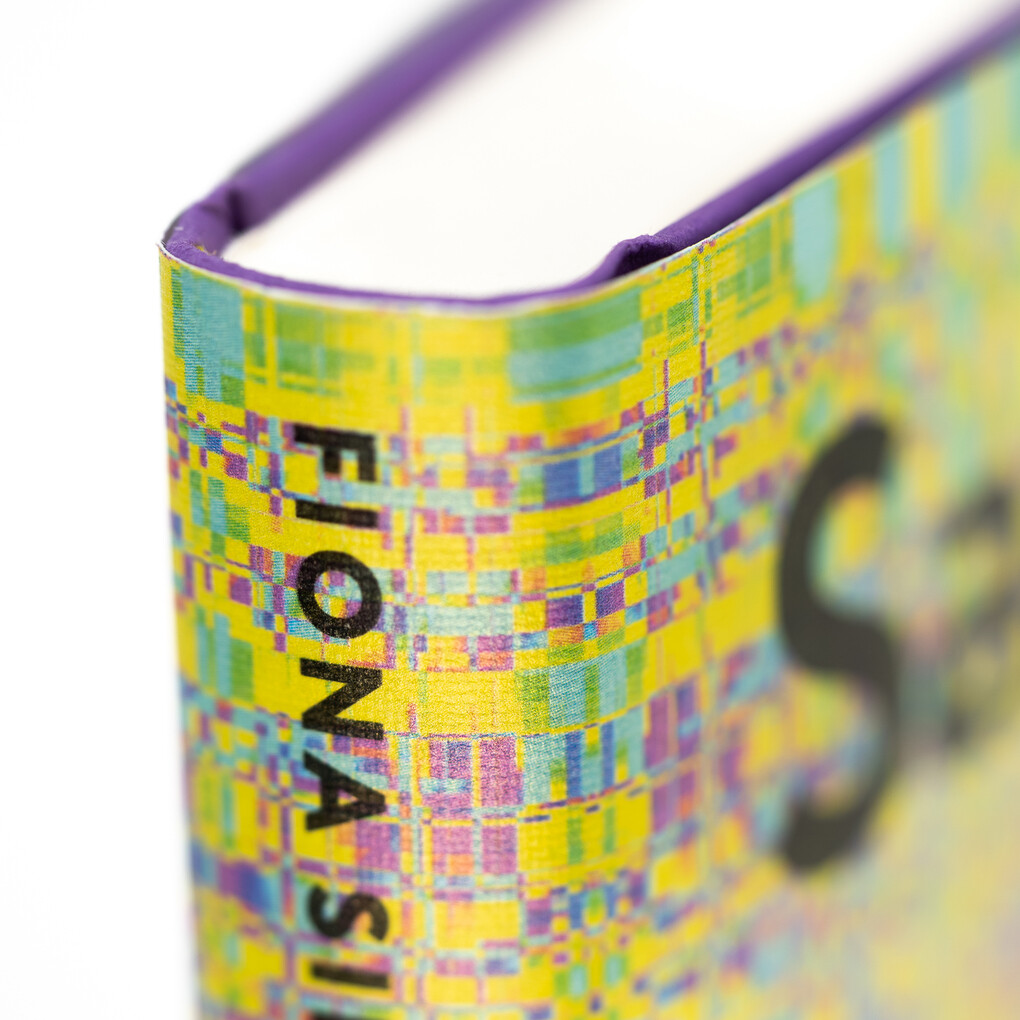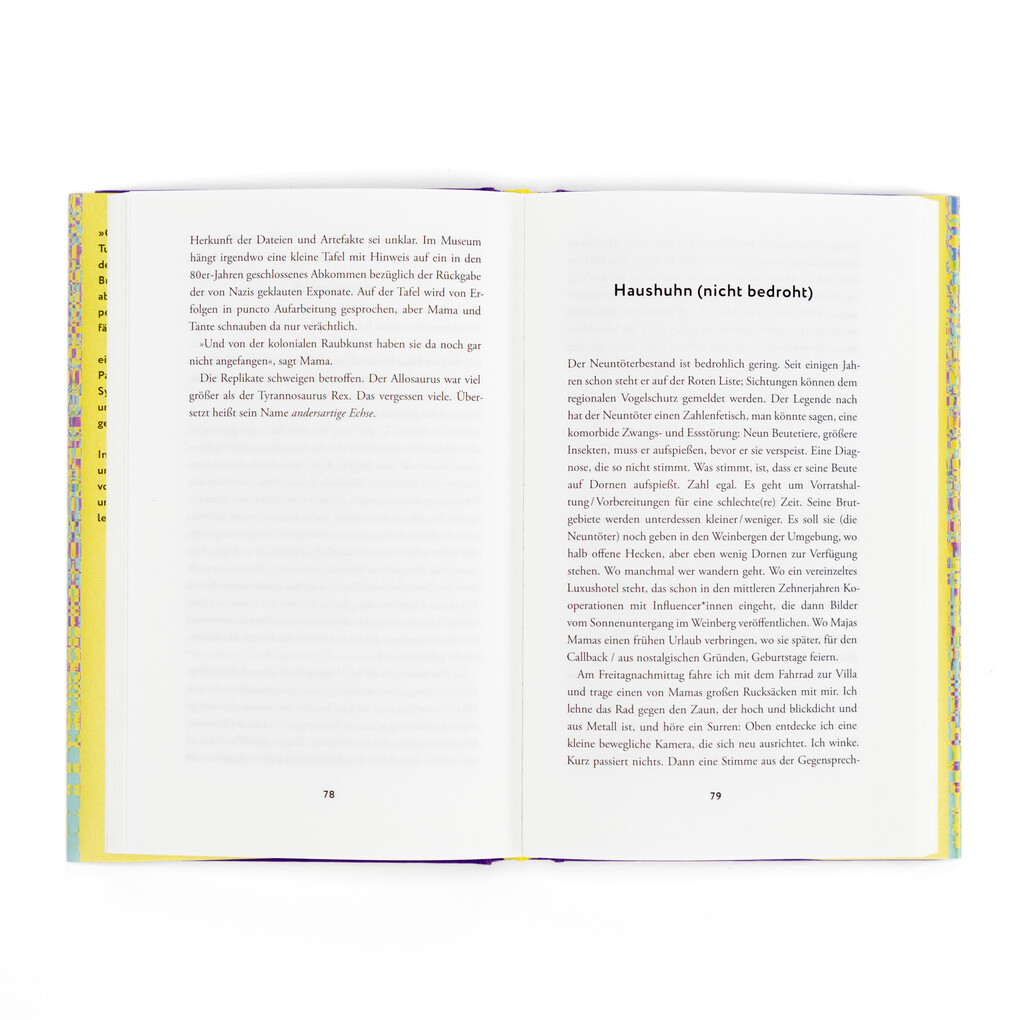Fiona Sironics Roman Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft wagt sich an Themen, die nicht nur aktuell, sondern hochbrisant sind. Im Zentrum steht die 15-jährige Era, die als Erzählerin und Beobachterin zugleich eine Brücke schlägt zwischen Natur und digitaler Welt, zwischen persönlicher Identität und gesellschaftlicher Überforderung. Bereits zu Beginn deutet sich an, dass dieser Text nicht nach gewohnten literarischen Mustern verläuft, sondern eine ungewöhnliche Mischung aus Coming-of-Age-Geschichte, Gesellschaftskritik und Zukunftsentwurf darstellt.
Era wächst in einer kleinen Hütte am Waldrand auf, abgeschirmt von der Außenwelt. Ihre Mutter und ihre Tante ziehen sie groß, wobei vor allem die Mutter den Rückzug ins Abseits als Schutzraum begreift. Diese Ausgangssituation verleiht dem Roman eine abgeschottete Grundatmosphäre, die sich in Eras Wahrnehmung und auch im Sprachstil niederschlägt. Gleichzeitig beschäftigt sich das Mädchen mit dem Aussterben von Vogelarten, das sie dokumentiert ein Hinweis darauf, dass ökologische Krisen hier eine ebenso wichtige Rolle spielen wie die Gefahren der digitalen Welt.
Über das Internet stößt Era auf eine Gruppe von Mädchen, die sich im Wald treffen und dort Dinge sprengen von Festplatten bis zu elektronischen Relikten einer Vergangenheit, die längst zur Last geworden ist. Obwohl die Jugendlichen ihre Gesichter verhüllen, erkennt Era die Lichtung im eigenen Wald und sogar eines der Mädchen: Maja. Diese war früher unfreiwillig im Mittelpunkt der Öffentlichkeit, da ihre Mütter als Momfluencerinnen das Aufwachsen ihrer Tochter im Netz ausstellte. Nun kämpft Maja damit, die Spuren dieser aufgezwungenen Öffentlichkeit loszuwerden, indem sie ihre frühere digitale Identität buchstäblich in die Luft jagt.
Durch ihre vorsichtige Annäherung an die Clique findet Era nicht nur Anschluss, sondern auch ihre erste große Liebe eben zu Maja. Doch die Welt, in der sich diese beiden Figuren bewegen, ist keineswegs stabil. Sie ist geprägt von ökologischen Katastrophen, von gesellschaftlichen Spannungen und einer zunehmenden Entfremdung zwischen analogem Leben und virtueller Dauerpräsenz. Ein Waldbrand von verheerendem Ausmaß bringt das ohnehin fragile Gefüge endgültig ins Wanken.
Die Stärke des Romans liegt in seiner Grundidee: Sironic verbindet digitale Themen, Fragen von Identität und Öffentlichkeit, sowie ökologische Bedrohungen zu einem Gesamtbild, das in eine nahe Zukunft verlegt ist. Dadurch treten Fehlentwicklungen, die in der Gegenwart bereits sichtbar sind, noch deutlicher hervor. Bemerkenswert ist, dass die Autorin konsequent aus der Perspektive einer Jugendlichen erzählt. Era ist in diese Welt hineingeboren, kennt sie nicht anders, und erlebt viele Dinge zum ersten Mal. Ihr Blick ist fragmentarisch, oft naiv und unpräzise.
Dieser gewählte Erzählton prägt das gesamte Buch: Die Sprache wirkt wie lose aneinandergereihte Gedankenfetzen, Grammatik und Satzbau erscheinen teilweise absichtlich brüchig. Die Leser sollen dadurch ganz in Eras Gedankenwelt eintauchen, was einerseits die Unmittelbarkeit der Figur stärkt, andererseits aber die Lektüre erheblich erschwert. Nicht alle werden sich mit diesem Stil anfreunden können für manche wirkt er originell, für andere schlicht nervenaufreibend.
Auch die Erzählstruktur selbst folgt keiner geradlinigen Linie. Zwar gibt es einen roten Faden, doch immer wieder wird er durch absurde, unerwartete Ereignisse unterbrochen. Die Figuren wirken eigensinnig, manchmal widersprüchlich, und gerade die Mädchen changieren zwischen Trotz, Frustration und einer Art grundsätzlicher Wut. Diese Weltwut scheint aus der Erfahrung heraus geboren zu sein, dass die digitale Welt, die einst Verheißung und Verlockung versprach, letztlich zur Quelle tiefer Enttäuschung geworden ist.
Besonders interessant ist der Perspektivwechsel, den Sironic vornimmt: Nicht die Jugendlichen sind hier die treibenden Kräfte einer enthemmten Selbstentblößung im Netz. Sie sind vielmehr Opfer ähnlich wie frühere Generationen Opfer des Umweltmissbrauchs durch ihre Eltern wurden. Damit positioniert der Roman die Teenager als Leidtragende, nicht als Täterinnen einer voyeuristischen Kultur.
So spannend dieses Konzept auch klingt, die Umsetzung überzeugt nur teilweise. Der jugendlich-naive Tonfall kann je nach Lesart als klug gewählte Perspektive oder als ermüdend empfunden werden. Zudem verliert die Handlung nach dem zunächst faszinierenden Aufbau an Kraft. Spätestens ab dem Waldbrand wirkt die Geschichte zerfahren, die Spannung weicht einem oft beliebigen Ablauf von Szenen. Auch die Zukunftswelt, die Sironic entwirft, schwankt zwischen düsterer Übertreibung und überambitionierter Symbolik. Schließlich fällt auf, dass die Autorin offenbar den Wunsch hatte, eine nahezu männerfreie Welt zu gestalten. Das wirkt einerseits provokant und bricht mit Konventionen, andererseits schränkt es die Vielschichtigkeit des Romans ein. Statt neue Perspektiven zu eröffnen, entsteht mitunter der Eindruck einer gewollten und unnötigen Einseitigkeit.
Insgesamt ist Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft ein Werk, das vieles wagt: Es ist provokant, überdreht, gelegentlich anklagend und manchmal moralisch zeigend. Doch bei aller Originalität bleibt die Umsetzung zu fragmentarisch, um das volle Potenzial auszuschöpfen. Sironics Roman ist mehr Experiment als vollendetes Werk und gerade deshalb spannend, aber auch frustrierend zugleich.