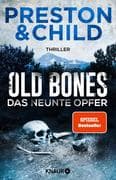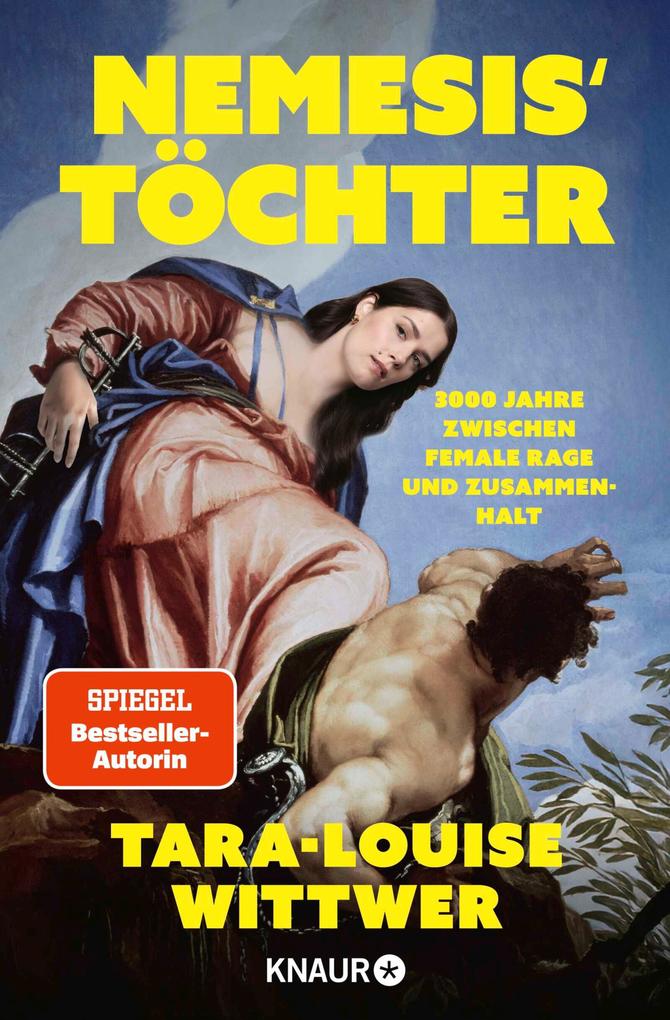Ein feministisches Plädoyer für weibliche Wut, das tief in Geschichte, Mythologie und Gegenwart eintaucht. Tara-Louise Wittwer, bekannt durch ihren Instagram-Account @wastarasagt, ist Kulturwissenschaftlerin, Autorin und Content Creatorin aus Berlin. Sie schreibt seit Jahren über Feminismus, Popkultur und Misogynie, klug, pointiert und immer mit einer Prise Ironie.
Worum gehts genau?
In Nemesis Töchter spürt Tara-Louise Wittwer der Frage nach, woher weibliche Wut kommt und warum sie so lange unterdrückt wurde. Sie greift 3000 Jahre Geschichte auf, von antiken Göttinnen bis zu modernen Pop-Ikonen, von Hexenverfolgungen bis zu #MeToo. Dabei zeigt sie, wie eng Misogynie mit Machtstrukturen, Religion und kapitalistischen Idealen verknüpft ist. Ich bin Nemesis Tochter, ich bin alle Frauen vor mir, so beginnt ihr Manifest der kollektiven Erinnerung und des Zusammenhalts. Wittwer erzählt von historischen Frauen, vergessenen Kämpferinnen und der transgenerationalen Weitergabe von Angst, Mut und Wut. Doch sie schreibt kein Buch über Wut, sondern, wie sie selbst sagt, ein Buch über Zusammenhalt.
Meine Meinung
Der Einstieg hat mich definitv sofort gepackt. Nicht zuletzt, weil darin auch die Zeilen aus dem Buchtrailer vorkommen, der mich überhaupt erst dazu gebracht hat, das Buch zu lesen. Insgesamt ist das Buch in einem poetisch, kraftvollen Tonfall geschrieben, der zwischen Essay, Manifest und persönlicher Reflexion wechselt. Wittwer gelingt es, komplexe feministische Themen in eine emotionale Alltagssprache zu übersetzen, die mit mir resoniert hat.
Besonders gelungen fand ich die Passagen, in denen sie aufzeigt, wie weibliche Wut politisch gemacht und gleichzeitig delegitimiert wird: Wut ist ein Machtinstrument und vor allem ist Wut soziales Kapital. (S. 21) Diese Gegenüberstellung männliche Wut als Leidenschaft, weibliche Wut als Hysterie trifft ins Mark. Auch ihr Satz Das liegt daran, dass Wut nicht nur eine Emotion ist, sondern dann, wenn man sie frei zeigen kann, auch ein Privileg (S. 19) bleibt hängen, weils eben in einer patriarchalen Welt ein überwiegend männliches Privileg ist.
Die Autorin schafft es auch, historische Perspektiven (etwa zu Hexenverfolgungen) mit aktuellen Debatten zu verknüpfen: Sie nennt Hexenprozesse Frauenverbrennungen, weil sie klar benennt, dass es sich letztlich um systematische Femizide handelte. Besonders interessant fand ich ihre Verknüpfung von Antisemitismus, Misogynie und Popkultur: Dass das Bild der Hexe in Europa antisemitische Ursprünge hat, war mir neu.
Trotz der vielen starken Gedanken hatte das Buch für mich in der Mitte Längen. Der rote Faden ging bei mir stellenweise verloren. Inhaltlich wiederholt sich manches und grad wenn man sich schon mit dem Thema befasst hat ist vielleicht nicht viel Neues mit dabei. Das mag daran liegen, dass Wittwer sich selbst als Einstiegsfeministin bezeichnet: Sie reicht die Hand in den Feminismus, ohne Fachbegriffe, ohne Vorkenntnisse zu erwarten. (S. 147) Das macht das Buch zugänglich, aber für Leser:innen, die bereits tiefer im Thema sind, bleibt es daher eher an der Oberfläche.
Gleichzeitig berühren viele Passagen durch ihre Emotionalität und Direktheit: Ich schreibe dieses Buch nicht, weil ich Männer hasse. Ich schreibe dieses Buch, weil ich Frauen liebe. (S. 198) Diese Haltung zieht sich durch alles, ein feministisches Schreiben aus Zuneigung und Solidarität, die mir sehr zusagt. Die Botschaft ist klar: Drei sind besser als eine, dreihundert sind besser als drei. Wir alle als Schwestern. (S. 190)
Fazit
Nemesis Töchter ist ein wichtiges, mutiges Buch über weibliche Wut, Verbundenheit und den langen Schatten patriarchaler Geschichte. Sprachlich eindringlich, inhaltlich an manchen Stellen repetitiv, aber voller Leidenschaft und Empowerment. Besonders empfehlenswert für alle, die sich neu mit Feminismus beschäftigen oder verstehen wollen, warum Wut politisch ist. Weniger geeignet für Leser:innen, die bereits tief in feministischer Theorie stecken.
Danke an Netgalley Deutschland und Knaur für das Rezensionsexemplar.