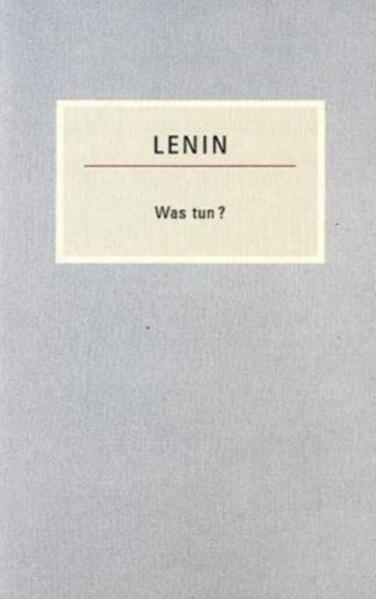Was tun? Das fragte sich Lenin in einer Zeit, um 1900, die der derzeitigen nicht unähnlich war. Opportunismus und Vulgarisierung, wie man damals zu sagen pflegte führten zur Krise des Marxismus. Der Marxismus stand zur Disposition. Die sozialdemokratischen Parteien waren alles, nur nicht revolutionär. Die Massen warteten aber auf politische Lösungen, da der Kapitalismus von Krise zu Krise taumelte. Und dann kam Lenin, wie man so schön sagt. Um was geht es in dem Büchlein? Es geht um die Frage der Beziehung von Theorie und Praxis. Im Streit zwischen Ökonomisten und der Bolschewiki zum Anfang des 20. Jahrhunderts entbrannte eine Diskussion um die Rolle der Organisierung. Während die eine Seite auf die Spontaneität der Massen setzte, also auf eine Selbstbewußtwerdung des Proletariats in Folge seiner ökonomischen Ausbeutung, vertrat Lenin das Konzept der Avantgarde; einer wechselseitigen Beziehung zwischen revolutionärer Partei und Proletariat. Wobei die Partei, die Massen aufklärt, agitiert und organisiert, sie über gewisse reale Grenzen der Selbsterkennung theoretisch hinweg hilft. Mit Was tun? begründete Lenin das Konzept der revolutionären Partei. Die Geschichte gab ihm Recht. Nur die Bolschewiki, als elastisches Vehikel zwischen revolutionärer Masse und Theorie, verloren 1917 nicht den Kontakt zu den Massen. Sie mutierte nicht zum Nachtrab der Bourgeosie sondern agierte als Vorhut des Proletariats. Das Prinzip der Avantgarde zeigte sich praxistauglich und verwandelte die Spontanität der Massen, die notwendige einzelne revolutionäre Schritte ermöglichte, in einen organisierten Gesamtwillen, eingebettet in die Ganzheit der Erkenntnisse. Der Sieg der sozialistischen Oktoberrevolution war das Ergebnis. Was lernt Mensch daraus?