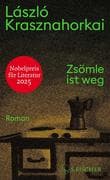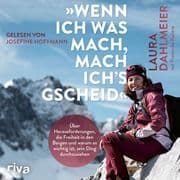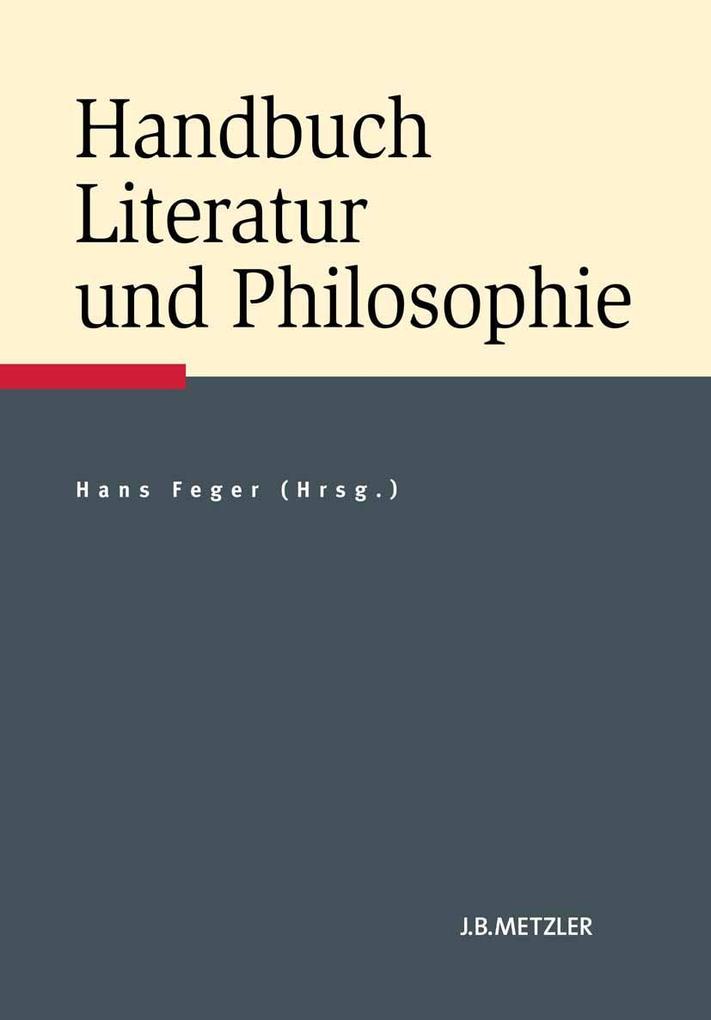Mit Philosophie verbindet man die Suche nach der begründeten Wahrheit, in der Dichtung erhebt man keinen Wahrheitsanspruch. Damit scheint ein tiefer Graben zwischen den beiden Bereichen zu liegen. Doch so einfach ist es nicht: jede gute Dichtung hat zumindest eine philosophische Grundierung. Den Graben will das Handbuch überbrücken. Dazu stellte der Herausgeber Hans Feger, Dozent an der FU Berlin, 16 Beiträge zusammen.
Das Thema legt die interdisziplinäre Ausrichtung fest. Entsprechend breit ist das Themenspektrum, das sowohl chronologisch als auch diachronisch behandelt wird.
Gleich in der Einleitung wird Richtung und Tiefe der Durchdringung des Stoffes mit Platon, Alexander Gottlieb Baumgarten, Immanuel Kant und Robert Musil festlegt. Wen diese Einleitung anregt, der findet in den folgendenBeiträgen eine Fülle von Ideen, verbindenden Elementen und Problemen, wenn sich Dichtung und Philosophie begegnen und interagieren. Neben den genannten Autoren der Einleitung werden besonders behandelt Goethe, Leibniz, Novalis, Hölderlin, Nietzsche, Cassirer, Hofmannsthal, Broch, Thomas Mann, Brecht, Sartre, Adorno. Die Liste ist keineswegs erschöpfend. Doch vermisste ich einige Literatenphilosophen wie Herman Melville und Bertrand Russell. Manche wie Jorge Luis Borges werden nur erwähnt, da ich hätte mir mehr gewünscht. Aufgrund der konzentrierten Texte kommt die Belegung mit praktischen Beispielen zu kurz. Selbst dem Kapitel 14, das auch auf Paradigmen und Gedankenexperimente eingeht, hätten einige breiter behandelten Beispiele gut getan.
Die klare Sprache, wenn auch mitunter recht akademisch (Nachschlagwerke vor der Lektüre bereitstellen!), erlaubt es, die Probleme im Schnittbereich zwischen Literatur und Philosophie gut zu erfassen und zu durchdringen. Das bewährte Konzept der Handbücher-Serie bei Metzler (verschiedene Autoren, Literaturverzeichnis nach jedem Beitrag, umfassende Auswahlbibliographie im Anhang) ermöglicht es gezielt einzusteigen und Themen zu vertiefen.