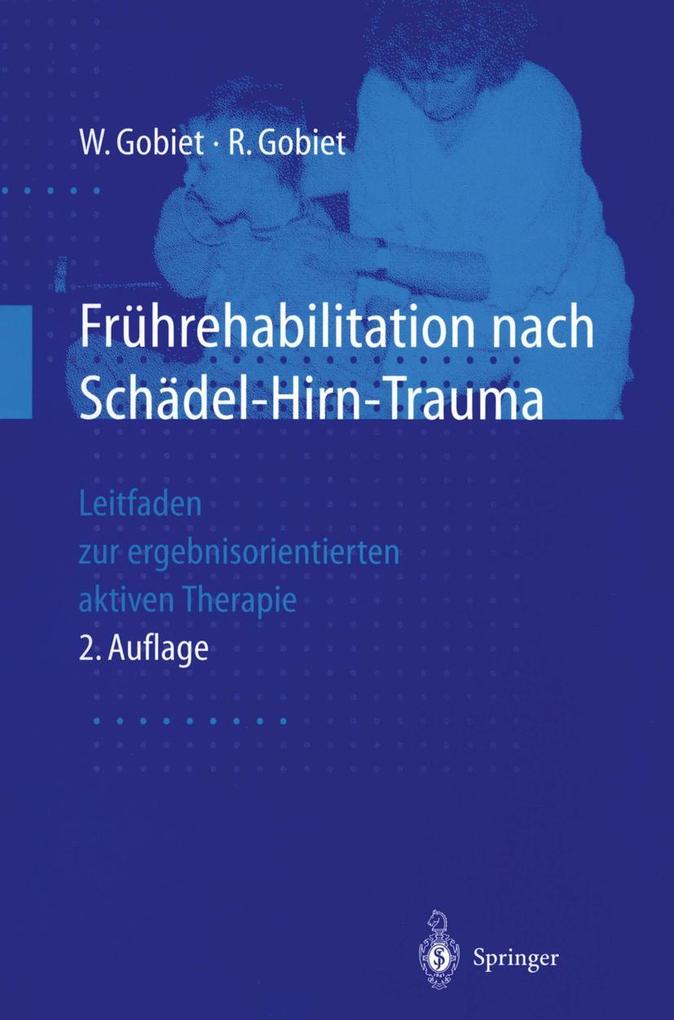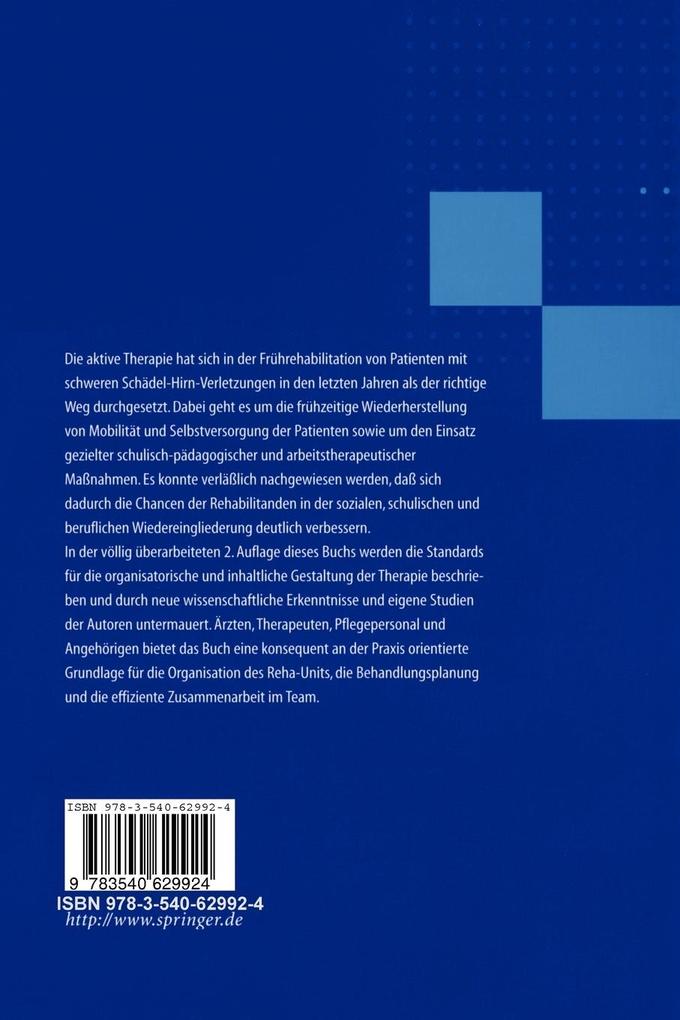Die aktive Therapie hat sich in der Frührehabilitation von Patienten mit schweren Schädel-Hirn-Verletzungen in den letzten Jahren als der richtige Weg durchgesetzt. Dabei geht es um die frühzeitige Wiederherstellung von Mobilität und Selbstversorgung der Patienten sowie um den Einsatz gezielter schulisch-pädagogischer und arbeitstherapeutischer Maßnahmen. Inzwischen konnte nachgewiesen werden, daß sich dadurch die Chancen der Rehabilitanden in der sozialen, schulischen und beruflichen Wiedereingliederung deutlich verbessern. In der völlig überarbeiteten 2. Auflage dieses Buchs werden die Standards für die organisatorische und inhaltliche Gestaltung der Therapie beschrieben und durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse und eigene Studien der Autoren untermauert. Ärzten, Therapeuten und Pflegepersonal bietet das Buch eine konsequent an der Praxis orientierte Grundlage für die Organisation des Reha-Units, die Behandlungsplanung und die effiziente Zusammenarbeit im Team.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung. - Inhaltliche und organisatorische Grundlagen. - 2. 1 Frührehabilitation (Phase Ib, IIa-B, C). - 2. 2 Medizinisch-berufliche Rehabilitation Phase II (C + D). - 2. 3 Schulische und berufliche Rehabilitation Phase III (E). - 2. 4 Dauerpflege. - 2. 5 Tagesklinische Behandlung. - 3 Personeller und organisatorischer Aufbau der Frührehabilitation. - 3. 1 Personelle Anforderung. - 3. 2 Bauliche Voraussetzungen. - 3. 3 Apparative Voraussetzungen. - 3. 4 Anbindung der Frührehabilitation. - 3. 5 Hygienische Voraussetzungen. - 3. 6 Personalbedarf. - 4 Schädigungsformen und Akutversorgung. - 4. 1 Großhirn und Hirnstamm. - 5 Bewußtseinslage und Hirnstammfunktionen. - 5. 1 Bewußtseinslage. - 5. 2 Hirnstammsyndrome. - 6 Medizinische Behandlung. - 6. 1 Intensivtherapie. - 6. 2 Rehabilitative pflegerische Therapie. - 6. 3 Besonderheiten des Krankheitsbildes. - 7 Zugangswege zum bewußtlosen Patienten. - 7. 1 Technische Untersuchungen. - 7. 2 Klinische Befunde. - 8 Therapeutische Grundlagen. - 8. 1 Allgemeine Hinweise. - 8. 2 Wertung der einzelnen Therapiemethoden. - 9 Reaktivierung der Motorik. - 9. 1 Normale Haltungsreflexe. - 9. 2 Pathologische Haltungsreflexe. - 9. 3 Antispastische Therapie. - 10 Besonderheiten im Erholungsverlauf. - 10. 1 Apallisches Syndrom. - 10. 2 Medizinische Behandlung des Patienten im apallischen Syndrom. - 10. 3 Grundlage der Therapie. - 10. 4 Multidisziplinäres Team. - 10. 5 Neuropädagogik. - 10. 6 Krankengymnastik. - 10. 7 Ergotherapie. - 10. 8 Einbeziehung von Angehörigen. - 10. 9 Zusammenfassung. - 11 Beginnende Remissionsphase. - 11. 1 Klinische Befunde. - 11. 2 Technische Untersuchungen. - 11. 3 Symptome der beginnenden Remission. - 11. 4 Ärztliche und pflegerische Behandlung. - 11. 5 Spezifische rehabilitative Maßnahmen. - 11. 6 Neuropädagogische Frühförderung. - 11. 7 Ergotherapie. - 11. 8 Krankengymnastik. - 11. 9Allgemeine Hinweise. - 12 Remissionsphase. - 12. 1 Beurteilung und Diagnostik. - 12. 2 Konsiliarische Untersuchungen. - 12. 3 Allgemeine Hinweise. - 12. 4 Ärztliche und pflegerische Maßnahmen. - 12. 5 Pflegerische Therapie. - 12. 6 Ergotherapie. - 12. 7 Krankengymnastik. - 12. 8 Neuropädagogische Therapie. - 12. 9 Gruppentherapie. - 13 Allgemeine Leistungsstörungen. - 13. 1 Orientierung. - 13. 2 Visuelle Störungen. - 13. 3 Antrieb. - 13. 4 Sozialverhalten. - 13. 5 Ungesteuerte Affekte. - 13. 6 Aggression. - 13. 7 Psychische Auffälligkeiten. - 13. 8 Motivation. - 13. 9 Konzentration/Aufmerksamkeit. - 13. 10 Gedächtnisstörung. - 13. 11 Denkfähigkeit. - 13. 12 Flexibilität. - 14 Sprachstörungen. - 14. 1 Aphasie. - 14. 2 Dysarthrie. - 14. 3 Allgemeine Hinweise. - 15 Kostenträger. - 16 Ergebnisse. - 16. 1 Wertung der Ergebnisse. - 16. 2 Prognose. - 17 Zeitpunkt der Deckelung von Knochendefekten. - 18 Beeinflussung des Heilungsverlaufes. - 19 Scoring-Systeme. - 20 Sozialdienst. - 21 Zusammenfassung. - 22 Literatur. - 23 Sachverzeichnis.