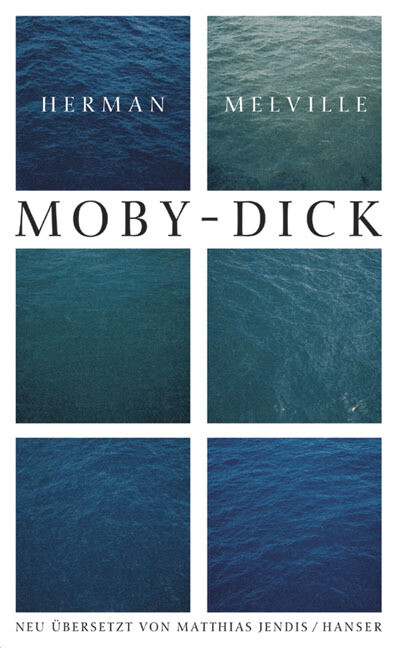
Zustellung: Do, 17.07. - Sa, 19.07.
Sofort lieferbar
Versandkostenfrei"Moby-Dick", einer der größten Romane der Weltliteratur, in einer Neuübersetzung, die Maßstäbe setzt: Die Geschichte des weißen Wals und seines von Haß getriebenen Jägers Kapitän Ahab wird in ihrer unendlichen Vielstimmigkeit, in ihrem Pathos und ihrer Präzision erzählt. Mit einem Anhang, der zu immer neuen Entdeckungen in diesem aus den tiefsten Quellen von Mythos und Philosophie schöpfenden Meisterwerk einlädt.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
17. September 2001
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
1048
Autor/Autorin
Herman Melville
Herausgegeben von
Daniel Göske
Übersetzung
Matthias Jendis
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
englisch
Produktart
gebunden
Gewicht
507 g
Größe (L/B/H)
194/123/30 mm
ISBN
9783446200791
Pressestimmen
"Es hat lange gedauert, bis die Welt bemerkt hat, was für ein Buch ihr da geschrieben worden ist." Joachim Kalka, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 06. 11. 01
Dieses Werk mit all seinem Geheimnis, es rollt dahin; es steigt an und fällt ab wie das Gebirge, wie der Sturzbach und das Meer. Er reißt uns fort und schlägt über uns zusammen." Jean Giono
"Melville hat vier Jahre seiner Jugend auf Walfangbooten und Kriegsschiffen verbracht und hatte mit Taifunen und Windstillen höllische und arkadische Abenteuer zu bestehen. Hier sammelte er den Stoff, den er später in seine Werke einschmolz." Cesare Pavese
"Was für ein Buch hat Melville da geschrieben! Ich finde darin eine viel größere Kraft als in allen seinen Büchern davor." Nathaniel Hawthorne
Dieses Werk mit all seinem Geheimnis, es rollt dahin; es steigt an und fällt ab wie das Gebirge, wie der Sturzbach und das Meer. Er reißt uns fort und schlägt über uns zusammen." Jean Giono
"Melville hat vier Jahre seiner Jugend auf Walfangbooten und Kriegsschiffen verbracht und hatte mit Taifunen und Windstillen höllische und arkadische Abenteuer zu bestehen. Hier sammelte er den Stoff, den er später in seine Werke einschmolz." Cesare Pavese
"Was für ein Buch hat Melville da geschrieben! Ich finde darin eine viel größere Kraft als in allen seinen Büchern davor." Nathaniel Hawthorne
Bewertungen
am 06.12.2006
der Trieb des Menschen zur Deutung der Welt
Melvilles berühmtester Roman, durch den sein Name wohl heller vom Sternenhimmel der Weltliteratur strahlt als der jedes anderen amerikanischen Schriftstellers des 19.Jahrhunderts, erschien in deutscher Sprache mit einiger Verspätung erstmals 1927 im Knaur-Verlag. Doch diese Übersetzung war nicht vollständig. Es handelte sich um eine auf die Ahabsgeschichte reduzierte, um die Hälfte des Umfangs zusammengekürzte Bearbeitung und damit um die Vorreiterin jener zahllosen Kinder-und Jugendbuchversionen, die seit den fünfziger Jahren auf den Markt kamen.
Die Übersetzung von Mathias Jendis, die der Hanser Verlag genau 150 Jahre nach der Publikation des Originals nun vorlegt, ist die erste, die auf einem vollständigen, gesicherten Ausgangstext beruht.
Das also, wodurch sich Melville mit Moby-Dick seine überragende Stellung unter den amerikanischen Schriftstellern gesichert hat, zeichnet sich erst in dieser Neuübersetzung von Jendis ab: Nämlich daß Melville mit Moby-Dick ein großes sprachliches Bauwerk in der Weltliteratur schuf.
Die kongeniale Übersetzung verbindet die rasante Abenteuerhandlung (Ahabs Jagd nach dem weißen Wal) und packende Schilderungen vom Alltag des Walfangs (damals der bedeutendste Industriezweig der jungen Nation) mit mal krass realistischen, oft aber auch poetischen Beschreibungen des Lebens auf hoher See.
Mehr noch: Der Erzählfaden wird ständig abgeschnitten oder neu verwoben mit Textgattungen und Stilformen, die in einem klassischen Roman eigentlich nichts verloren haben: Theatralische Szenen im hohen Ton der Tragödie oder im launigen Parlando des Lustspiels wechseln mit Predigten, naturkundlichen Essays, satirischen Parodien, zeitkritischen Pamphleten , Anlehnungen an antiken Mythen , Geschichten aus der Bibel bis hin zu philosophischen Reflexionen über Kunst, Religionen und Ökonomie.
Das verbindende Element aller dieser Teile ist Ismael, der Ich-Erzähler: In der Handlung spielt er nur eine untergeordnete Rolle. Aber als Erzähler, als fiktiver Autor ist Ismael der eigentliche Held des Buches
Das Thema des monumentalen Werkes ist der Trieb des Menschen zur Deutung der Welt und zur Selbstvergewisserung im Reden und Schreiben. Melvilles Buch ist vernarrt in die Sprache. Es ist, jenseits der schauerromantischen Abenteuerhandlung, eine zeitlos moderne Geschichte über das Lesen, das Erzählen, die Spekulation und die Phantasie.








