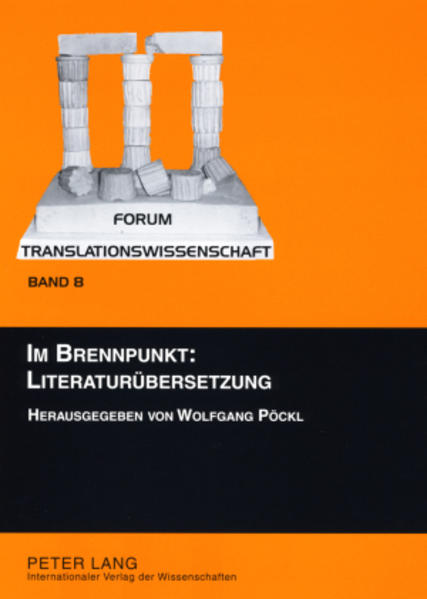Das Schicksal literarischer Übersetzungen wird von einer Vielfalt von Faktoren bestimmt. ÜbersetzerInnen und ihre translationstheoretischen Überzeugungen sowie die oft präzisen Vorgaben von Verlagen - z. B. bezüglich Umfang der Publikation, Anmerkungsapparat, sprachlicher Färbung - haben erheblichen Einfluss auf die Gestalt der Texte. Deren Rezeption wiederum wird nachhaltig etwa durch Besprechungen in der Presse oder durch wichtige Auszeichnungen, die einem/r Übersetzer/in verliehen werden, gesteuert. Die Beiträge illustrieren das Zusammenwirken solcher Aspekte an unterschiedlichen Konstellationen, wobei das Panorama der Texte von antiken Klassikern über frühneuzeitliche Reiseberichte bis zu zeitgenössischer Höhenkammliteratur - z. B. Elfriede Jelinek - reicht. Das Spektrum der Zielsprachen umfasst neben Deutsch auch Italienisch und die Kreolsprache Papiamentu.
Inhaltsverzeichnis
Aus dem Inhalt
: Lew Zybatow: Literaturübersetzung im Rahmen der Allgemeinen Translationstheorie Rainer Kohlmayer: Mediale Voraussetzungen und strukturelle Besonderheiten des Literaturübersetzens. Reflexionen eines Praktikers Karlheinz Töchterle: Im Spannungsfeld zwischen Ausgangs- und Zielsprache: Zur Geschichte des Übersetzens aus den alten Sprachen Irene Weber Henking: Das
Centre de Traduction Littéraire de Lausanne
Marlies Straub:
Ein Bolero für den Kommissar
von Lorenzo Lunar Cardedo: Literarisches Übersetzen aus dem Kubanischen Peter Holzer: Übersetzerpreise für literarische Übersetzungen - wichtiges Instrument der Evaluierung übersetzerischer Leistungen Saverio Carpentieri: Melchiorre Cesarotti als Übersetzer Eva Eckkrammer: Ausbaufaktor literarische Übersetzung zwischen Planung und Willkür. Am Beispiel kreolischer Sprachen Johann Pögl: Ein translatorischer `Kamelritt . Das Itinerarium des portugiesischen Orientreisenden António Tenreiro und seine deutsche Übersetzung Waltraud Kolb:
I and I ways
. Die Sprache der Rastafari in deutscher Übersetzung Angelika Moser: Elfriede Jelinek: Übersetzerische Rezeption in Italien.