NEU: Das eBook.de Hörbuch Abo - jederzeit, überall, für nur 7,95 € monatlich!
Jetzt entdecken
mehr erfahren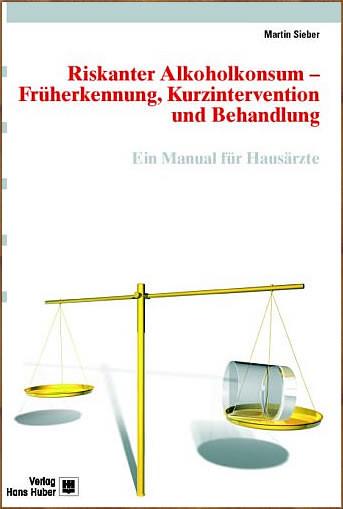
Sofort lieferbar (Download)
In der ärztlichen und psychotherapeutischen Praxis erscheinen oft Klienten, die anscheinend ein Alkoholproblem haben, jedoch nicht deswegen in die Sprechstunde gekommen sind. Ärzte oder Psychotherapeuten müssen sich dann die Frage stellen, in welcher Form und wie intensiv sie die Person auf die Alkoholproblematik ansprechen sollen. Sie müssen mit abweisenden Reaktionen, ja mit Abbruch der therapeutischen Beziehung rechnen. Dieses Spannungsfeld wird im vorliegenden Buch angesprochen und ein Vorschlag unterbreitet, wie solche Situationen angepackt werden können. Im Hintergrund steht eine therapeutische Grundhaltung, die beide Seiten als "Experten" deklariert. Ferner wird speziell auf die "Motivationsarbeit" verwiesen, d. h. auf den Aufbau in kleinen Schritten. Denn bewusst geplante und eingeleitete Verhaltensänderungen wirken nachhaltiger als unreflektierte, oft zu hoch gegriffene Ziele. Die Kurzintervention in der hausärztlichen Praxis hat entscheidende Bedeutung, da der Hausarzt oft die erste Fachperson ist, die das Alkoholproblem erkennen kann. Umso wichtiger ist ein realistisches, unaufwändiges Konzept für die Früherkennung und Behandlung.
Inhaltsverzeichnis
1;Inhaltsverzeichnis;6 2;Vorwort;10 3;1. Einleitung;12 3.1;1.1 Klinische Relevanz der Kurzintervention;12 3.2;1.2 Die Philosophie der Kurzintervention;14 3.3;1.3 Die Ziele des Manuals;15 3.4;1.4 Aufbau des Manuals;16 3.5;1.5 Zum Anhang;19 4;2. Erkennen des Risikokonsums;20 4.1;2.1 Hinweise auf einen Risikokonsum;20 4.2;2.2 Befragung zum Risikokonsum;21 4.2.1;2.2.1 Vorbemerkungen;21 4.2.2;2.2.2 Drei Risikobereiche;23 4.3;2.3 Beurteilung und Mitteilung durch den Arzt;29 4.4;2.4 Bewertung durch den Patienten, Integration der beiden Expertenmeinungen;31 4.4.1;2.4.1 Kein oder nur geringes Risiko;31 4.4.2;2.4.2 Risikokonsum;31 5;3. Kurzintervention;34 5.1;3.1 Wahl der Interventionsform;34 5.1.1;3.1.1 Kooperation mit Fachperson/Überweisung;34 5.1.2;3.1.2 Kurzintervention in der eigenen Praxis;35 5.2;3.2 Ratschlag;35 5.3;3.3 Kurzintervention;36 5.3.1;3.3.1 Motivationsklärung;36 5.3.2;3.3.2 Konkretisierung der Veränderung;40 5.4;3.4 Beratungsplan, Prozedere;45 5.5;3.5 Entschlussfassung;47 5.6;3.6 Aufrechterhaltung der Veränderung;47 5.7;3.7 Ausrutscher, Rückfälle;48 5.8;3.8 Schlussbemerkungen;49 6;ANHANG;52 6.1;Anhang 1: Motivation zur Verhaltensänderung;54 6.1.1;1.1 Phasenmodelle der Motivation;54 6.1.1.1;1.1.1 Das Modell von Prochaska und DiClemente;54 6.1.1.2;1.1.2 Die sechs Zwischenziele gemäss Feuerlein (1989);62 6.1.1.3;1.1.3 Fünf Stufen der Motivation von Hänsel (1981);62 6.1.2;1.2 Fallbeispiel;63 6.1.3;1.3 Dimensionen der Motivationsarbeit;64 6.1.4;1.4 Das Health-Belief-Model;64 6.1.4.1;1.4.1 Der wahrgenommene Schweregrad;65 6.1.4.2;1.4.2 Die wahrgenommene Anfälligkeit;67 6.1.4.3;1.4.3 Wahrgenommener Nutzen;67 6.1.4.4;1.4.4 Wahrgenommene Hindernisse;67 6.1.5;1.5 Das Rubikonmodell;68 6.2;Anhang 2: Beratung und Gesprächsführung;70 6.2.1;2.1 Voraussetzungen;70 6.2.1.1;2.1.1 Die sieben Grundregeln der Motivationsarbeit;70 6.2.1.2;2.1.2 PERLS: Fünf Aspekte der wirkungsvollen Beratung;71 6.2.2;2.2 Motivierende Gesprächsführung;72 6.2.2.1;2.2.1 Das Konzept von Miller und Ro
llnick;72 6.2.2.2;2.2.2 Instrumente zur Erfassung der Veränderungsbereitschaft;79 6.2.2.3;2.2.3 Grenzen der motivierenden Gesprächsführung;80 6.2.3;2.3 Heikle Klippen und Irrtümer;82 6.3;Anhang 3: Diagnostik;88 6.3.1;3.1 Was ist ein Standarddrink?;88 6.3.2;3.2 Alkoholgehalt im Blut;88 6.3.3;3.3 Anzahl Gläser und Blutalkoholspiegel;89 6.3.4;3.4 Alkoholgehalt verschiedener Getränke;90 6.3.5;3.5 Definition der Risikomenge;91 6.3.6;3.6 Abhängigkeit, Toleranzentwicklung;92 6.3.6.1;3.6.1 Abhängigkeitssyndrom nach ICD-10;92 6.3.6.2;3.6.2 Diagnosekriterien nach DSM-IV (APA, 1994);93 6.3.6.3;3.6.3 Selbstbeurteilungsfragebogen AUDIT;94 6.3.7;3.7 Risikoindikatoren für problematischen Konsum;96 6.3.8;3.8 Labordiagnostik;97 6.4;Anhang 4: Beratung spezieller Gruppen;99 6.4.1;4.1 Behandlung bei akutem Alkoholentzug;99 6.4.2;4.2 Behandlung bei Schwerabhängigen;100 6.4.3;4.3 Alkohol und Gewalt in der Familie;103 6.4.4;4.4 Kinder Alkohol missbrauchender Eltern;104 6.4.5;4.5 Jugendliche und junge Erwachsene;104 6.4.6;4.6 Alkohol bei Schwangeren;106 6.4.7;4.7 Ältere Bevölkerung;106 6.4.8;4.8 Psychisch Kranke, Doppeldiagnosen;107 6.4.9;4.9 Spitalpatienten;107 6.4.10;4.10 Epileptiker;108 6.4.11;4.11 Alkoholkonsum unter Ärzten;109 6.4.12;4.12 Alkohol und Spiritualität;110 6.4.13;4.13 Diverse Gruppen;110 6.5;Anhang 5: Epidemiologie und Evaluations- forschung;114 6.5.1;5.1 Epidemiologie;114 6.5.1.1;5.1.1 Alkoholkonsum in der Schweiz;114 6.5.1.2;5.1.2 Alkoholkonsum in Deutschland und Österreich;118 6.5.2;5.2 Wirksamkeit der Kurzintervention;119 6.5.2.1;5.2.1 Kurzintervention durch den Hausarzt bei Problemtrinkern;119 6.5.2.2;5.2.2 Andere Studien zur Wirksamkeit der Kurzintervention und Motivationsarbeit;120 6.6;Anhang 6: Verzeichnis der Institutionen im Alkohol- und Drogenbereich;123 6.7;Anhang 7: Merkblätter;124 6.7.1;Ermittlung des Risikokonsums;126 6.7.2;Früherkennung / Kurzintervention (Blatt 1);127 6.7.3;Trink- resp. Abstinenz-Agenda;130 6.7.4;Positive und negative Aspekte des Trinkens;
131 6.7.5;Was ist ein Standarddrink?;132 6.7.6;Entscheidungsmatrix;133 6.7.7;Anzahl Gläser und Blutalkoholspiegel;134 6.7.8;Alkoholgehalt verschiedener Getränke;135 7;Bibliographie;136 8;Sachregister;142
llnick;72 6.2.2.2;2.2.2 Instrumente zur Erfassung der Veränderungsbereitschaft;79 6.2.2.3;2.2.3 Grenzen der motivierenden Gesprächsführung;80 6.2.3;2.3 Heikle Klippen und Irrtümer;82 6.3;Anhang 3: Diagnostik;88 6.3.1;3.1 Was ist ein Standarddrink?;88 6.3.2;3.2 Alkoholgehalt im Blut;88 6.3.3;3.3 Anzahl Gläser und Blutalkoholspiegel;89 6.3.4;3.4 Alkoholgehalt verschiedener Getränke;90 6.3.5;3.5 Definition der Risikomenge;91 6.3.6;3.6 Abhängigkeit, Toleranzentwicklung;92 6.3.6.1;3.6.1 Abhängigkeitssyndrom nach ICD-10;92 6.3.6.2;3.6.2 Diagnosekriterien nach DSM-IV (APA, 1994);93 6.3.6.3;3.6.3 Selbstbeurteilungsfragebogen AUDIT;94 6.3.7;3.7 Risikoindikatoren für problematischen Konsum;96 6.3.8;3.8 Labordiagnostik;97 6.4;Anhang 4: Beratung spezieller Gruppen;99 6.4.1;4.1 Behandlung bei akutem Alkoholentzug;99 6.4.2;4.2 Behandlung bei Schwerabhängigen;100 6.4.3;4.3 Alkohol und Gewalt in der Familie;103 6.4.4;4.4 Kinder Alkohol missbrauchender Eltern;104 6.4.5;4.5 Jugendliche und junge Erwachsene;104 6.4.6;4.6 Alkohol bei Schwangeren;106 6.4.7;4.7 Ältere Bevölkerung;106 6.4.8;4.8 Psychisch Kranke, Doppeldiagnosen;107 6.4.9;4.9 Spitalpatienten;107 6.4.10;4.10 Epileptiker;108 6.4.11;4.11 Alkoholkonsum unter Ärzten;109 6.4.12;4.12 Alkohol und Spiritualität;110 6.4.13;4.13 Diverse Gruppen;110 6.5;Anhang 5: Epidemiologie und Evaluations- forschung;114 6.5.1;5.1 Epidemiologie;114 6.5.1.1;5.1.1 Alkoholkonsum in der Schweiz;114 6.5.1.2;5.1.2 Alkoholkonsum in Deutschland und Österreich;118 6.5.2;5.2 Wirksamkeit der Kurzintervention;119 6.5.2.1;5.2.1 Kurzintervention durch den Hausarzt bei Problemtrinkern;119 6.5.2.2;5.2.2 Andere Studien zur Wirksamkeit der Kurzintervention und Motivationsarbeit;120 6.6;Anhang 6: Verzeichnis der Institutionen im Alkohol- und Drogenbereich;123 6.7;Anhang 7: Merkblätter;124 6.7.1;Ermittlung des Risikokonsums;126 6.7.2;Früherkennung / Kurzintervention (Blatt 1);127 6.7.3;Trink- resp. Abstinenz-Agenda;130 6.7.4;Positive und negative Aspekte des Trinkens;
131 6.7.5;Was ist ein Standarddrink?;132 6.7.6;Entscheidungsmatrix;133 6.7.7;Anzahl Gläser und Blutalkoholspiegel;134 6.7.8;Alkoholgehalt verschiedener Getränke;135 7;Bibliographie;136 8;Sachregister;142
Produktdetails
Erscheinungsdatum
01. Januar 2005
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
144
Dateigröße
1,68 MB
Autor/Autorin
Martin Sieber
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
PDF
ISBN
9783456942025
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Riskanter Alkoholkonsum" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.








