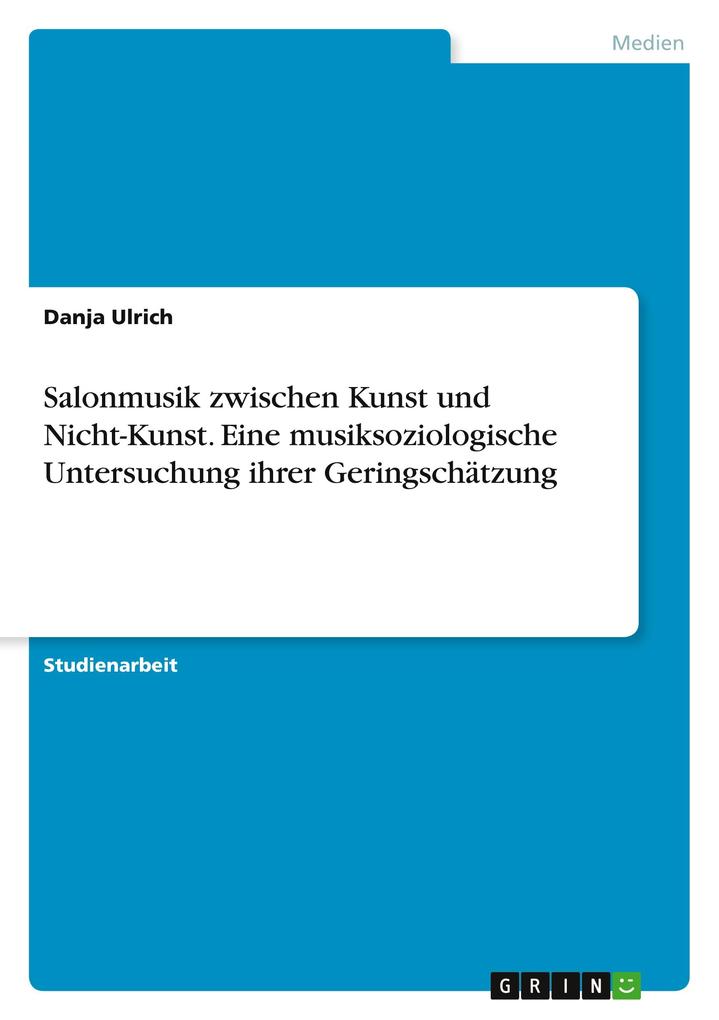
Zustellung: Fr, 04.07. - Mo, 07.07.
Versand in 2 Tagen
VersandkostenfreiStudienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Musik - Sonstiges, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitä t Bonn, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Musik des 19. Jahrhunderts ist heutzutage verbunden mit Kü nstlern wie Ludwig van Beethoven, Franz Liszt oder Robert Schumann. Komponisten also, die der Ernsten Musik1 zugeordnet werden. Die vorliegende Arbeit betrachtet dagegen die als Unterhaltungsmusik klassifizierte und im 19. Jahrhundert sehr populä re Salonmusik. Salonmusik, von den Musikverlagen als prosperierender Wirtschaftszweig genutzt, wurde damals zwar bevorzugt gedruckt, verlegt und verkauft, jedoch findet sie in der Geschichtsschreibung kaum Erwä hnung. Ihre zeitgenö ssische Wertschä tzung steht damit proportional verkehrt zu ihrer quantitativen Verbreitung. Die Grü nde fü r diese Tatsache wird die vorliegende Arbeit nä her beleuchten, indem sie untersucht, unter welchen Rahmenbedingungen Salonmusik komponiert, rezipiert und verkauft wurde. Als musiksoziologisch intendierte Arbeit wird die Salonmusik als ein gesellschaftlich-soziokulturelles Phä nomen betrachtet. Im Mittelpunkt stehen daher vor allem die unterschiedlichen Einflü sse einer im Wandel begriffenen Gesellschaft auf die Salonmusik.
Als exogene Wirkungskrä fte sollen die Komplexe Publikum, Musikverlag und Komponist als Koordinaten verstanden werden, zwischen denen sich ein Netz aus Prozessen, Akteuren und wechselseitigen Einflü ssen spannt. Da Musikverlage gegenü ber Publikum und Komponisten eine Vermittlerrolle einnehmen, stehen sie im Mittelpunkt dieses Netzes. Im Zentrum der Fragestellung wird die Praxis der Musikverlage und ihr Einfluss auf die Salonmusik behandelt. Hierzu werden im ersten Abschnitt 'Publikum' die Funktionen und ausü benden Akteure der Salonmusik beleuchtet. Im zweiten Abschnitt 'Musikverlag' wird untersucht, wie Anfang des 19. Jahrhunderts ein Massenmarkt fü r Salonmusik entstehen konnte, der Voraussetzung fü r ein wirtschaftlich erfolgreiches Arbeiten der Verlage war. Ebenfalls wird in diesem Abschnitt untersucht, inwiefern sich die Verlage an den Prä ferenzen der Abnehmerseite orientierten und welche Einflü sse diese Praxis gezielt auf die Salonmusik hatte. Anschließ end wird im Abschnitt 'Komponist' das Verhä ltnis zwischen beiden Parteien untersucht, speziell im Hinblick auf die Frage, welchen Einfluss die Verleger auf das ä sthetische Schaffen der Komponisten nahmen.
Als exogene Wirkungskrä fte sollen die Komplexe Publikum, Musikverlag und Komponist als Koordinaten verstanden werden, zwischen denen sich ein Netz aus Prozessen, Akteuren und wechselseitigen Einflü ssen spannt. Da Musikverlage gegenü ber Publikum und Komponisten eine Vermittlerrolle einnehmen, stehen sie im Mittelpunkt dieses Netzes. Im Zentrum der Fragestellung wird die Praxis der Musikverlage und ihr Einfluss auf die Salonmusik behandelt. Hierzu werden im ersten Abschnitt 'Publikum' die Funktionen und ausü benden Akteure der Salonmusik beleuchtet. Im zweiten Abschnitt 'Musikverlag' wird untersucht, wie Anfang des 19. Jahrhunderts ein Massenmarkt fü r Salonmusik entstehen konnte, der Voraussetzung fü r ein wirtschaftlich erfolgreiches Arbeiten der Verlage war. Ebenfalls wird in diesem Abschnitt untersucht, inwiefern sich die Verlage an den Prä ferenzen der Abnehmerseite orientierten und welche Einflü sse diese Praxis gezielt auf die Salonmusik hatte. Anschließ end wird im Abschnitt 'Komponist' das Verhä ltnis zwischen beiden Parteien untersucht, speziell im Hinblick auf die Frage, welchen Einfluss die Verleger auf das ä sthetische Schaffen der Komponisten nahmen.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
21. Februar 2012
Sprache
deutsch
Auflage
2. Auflage
Seitenanzahl
36
Autor/Autorin
Danja Ulrich
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Gewicht
68 g
Größe (L/B/H)
210/148/4 mm
ISBN
9783656130307
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Salonmusik zwischen Kunst und Nicht-Kunst. Eine musiksoziologische Untersuchung ihrer Geringschätzung" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.







