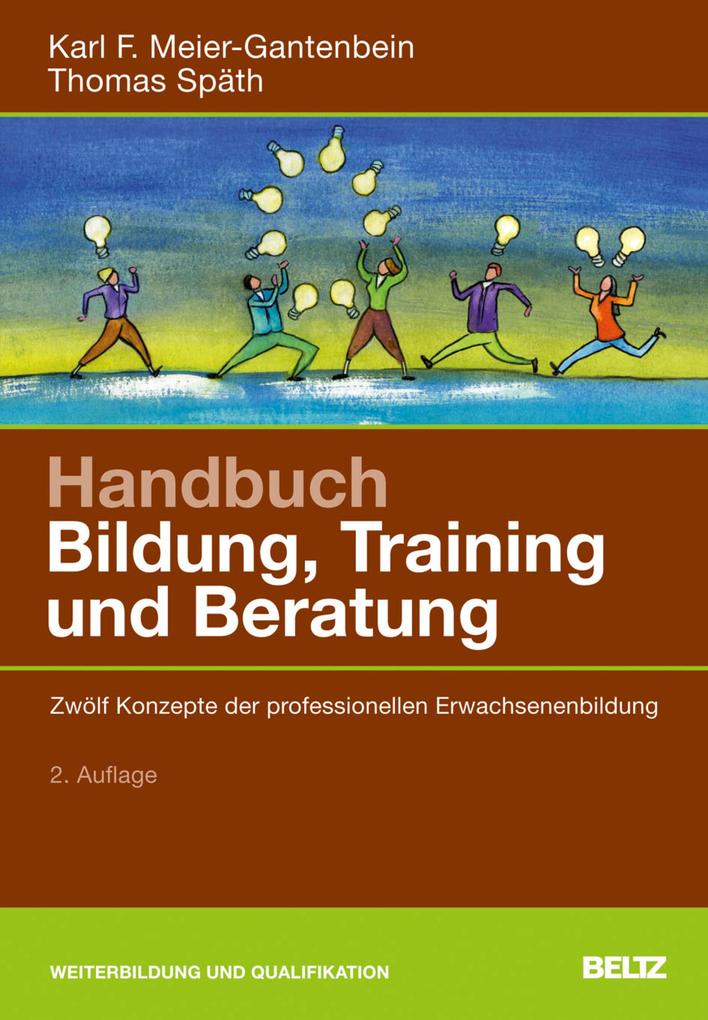Professionell gestaltete Veranstaltungsdesigns sind das Markenzeichen erfolgreicher Praktiker in der Erwachsenenbildung. Sie realisieren diese auf der Grundlage einer klaren konzeptionellen Zuordnung. Die Autoren stellen die wichtigsten Hintergrundkonzepte ihrer langjährigen Berufspraxis vor und geben so Einblicke in ihre Arbeit in Training, Beratung und Organisationsentwicklung.
Die zwölf wichtigsten Konzepte der Erwachsenenbildung - zum Beispiel Gestaltansatz, Themenzentrierte Interaktion, systemischer Ansatz, NLP - werden ausführlich beschrieben mit konkreten Anwendungsbeispielen und Einsatzmöglichkeiten.
Die beiden neuen Konzepte »Lösungsorientierte Kurztherapie« und »Der provokative Stil«, die aus der psychotherapeutischen Praxis kommen, sind inzwischen im Coaching, in der Beratung und im Training fest etabliert.
»Endlich gibt es ein solches Buch. Es sollte in keiner Bibliothek einer Bildungseinrichtung fehlen. « Außerschulische Bildung
Inhaltsverzeichnis
1;Inhaltsverzeichnis;6 2;Einleitung;17 3;Lernen Erwachsene anders?;19 3.1;Erwachsenenbildung aus lernpsychologischer Sicht;19 4;Nur nicht aus der Rolle fallen;21 4.1;Einordnung der Trainerrolle in der Bildungsarbeit mit Erwachsenen;21 4.1.1;Traineranforderungen und Trainerprofil;21 4.1.2;Abgrenzung zu benachbarten Tätigkeitsfeldern;23 4.1.3;Die neue Herausforderung: Prozesse gestalten;25 5;Die Zutaten sind nicht das Gericht;30 5.1;Ausgewählte Hintergrundkonzepte;30 6;Auf den Punkt gebracht;32 6.1;Die Konzepte im Detail;32 6.1.1;Konzept 1: Hirnforschung;32 6.1.2;Konzept 2: Kommunikation (Schulz von Thun);32 6.1.3;Konzept 3: Die Transaktionsanalyse (TA);33 6.1.4;Konzept 4: Themenzentrierte Interaktion (TZI);33 6.1.5;Konzept 5: Neurolinguistisches Programmieren (NLP);34 6.1.6;Konzept 6: Gestaltansatz;35 6.1.7;Konzept 7: Psychodrama;35 6.1.8;Konzept 8: Handlungslernen;36 6.1.9;Konzept 9: Konstruktivismus;36 6.1.10;Konzept 10: Systemischer Ansatz;37 6.1.11;Konzept 11: Lösungsorientierte Kurztherapie und Beratung;37 6.1.12;Konzept 12: Der Provokative Stil;38 7;Konzept 1 Hirnforschung: Gebrauchsanleitung für das menschliche Gehirn Die wichtigsten Erkenntnisse der Hirnforschung;40 7.1;Einführung und Geschichte;41 7.2;Was steckt dahinter?;44 7.2.1;Die Erkenntnisse moderner Hirnforschung und ihre Konsequenzen fürLernen und Lehren;44 7.2.2;Etwas Grundlagentheorie;44 7.2.3;Lernen und Veränderung aus neurobiologischer Sicht;46 7.2.4;Vom seltsamen Umgang mit großen Datenmengen;48 7.2.5;Die gehirneigene Drogenapotheke die Neurotransmitter;49 7.2.6;Die Hemisphärentheorie und ihre Konsequenzen;51 7.2.7;Das Gehirn bildet seine Regeln selbst;52 7.2.8;Lernen mit Struktur und Prioritäten;52 7.2.9;Kein Denken, Handeln und Lernen ohne Fühlen;53 7.2.10;Unser Gehirn kennt keine Objektivität Selbstorganisation;54 7.2.11;Auf die Nutzung kommt es an;55 7.2.12;Lebenslanges Lernen;56 7.2.13;Handlungslernen;57 7.2.14;Übung macht den Meister;57 7.2.15;Soziales Lernen die Spiegelzellen;58 7.2.16;Po
sitive Veränderungen durch mentales Training;59 7.2.17;Das Unterbewusstsein nutzen Priming;60 7.2.18;Lernen im Schlaf Suggestopädie;63 7.2.19;Die Rahmenbedingungen;65 7.3;Ethik, Werte und kritische Betrachtungen;66 7.3.1;Tierexperimente;66 7.3.2;Willensfreiheit;67 7.3.3;Hirnoptimierung durch Medikamente;67 7.3.4;Das Qualia-Problem;68 7.4;Methodische Ansätze;69 7.5;Essenz und Bedeutung;70 7.5.1;Literatur;71 8;Konzept 2 Kommunikation: Wie bring ichs rüber? Die Kommunikationsmodelle von Friedemann Schulz von Thun in der Trainingspraxis;72 8.1;Einführung und Geschichte;73 8.2;Was steckt dahinter?;74 8.2.1;Kommunikation nach Schulz von Thun;74 8.2.1.1;Das Ideal der Stimmigkeit;74 8.2.1.2;Metakommunikation;74 8.2.1.3;Modelle für die Wahrnehmung und Diagnose von Kommunikationssituationen;75 8.2.2;Ethik, Werte und kritische Betrachtungen;76 8.2.2.1;Die duale Ethik der Kommunikation;76 8.2.2.2;Die Grenzen;77 8.2.3;Methodische Ansätze;78 8.2.3.1;Das Kommunikationsquadrat;78 8.2.3.2;Der Teufelskreis;81 8.2.3.3;Das innere Team;84 8.2.3.4;Das Werte- und Entwicklungsquadrat;86 8.2.3.5;Das Situationsmodell;88 8.3;Essenz und Bedeutung;90 8.3.1;Literatur;91 9;Konzept 3 Transaktionsanalyse (TA): Gelungene Kommunikation ist kein Zufall Ethik, Reflexionshintergrund und Methodenkoffer in der Erwachsenenbildung und Beratung;92 9.1;Einführung und Geschichte;93 9.2;Was steckt dahinter?;96 9.2.1;Die Konzepte der TA als Reflexionshintergrund und Methodenkoffer imTraining und in der Beratung;96 9.2.2;Konzepte zum Verständnis der Persönlichkeit;97 9.2.3;Analyse und Gestaltung von Kommunikation und Beziehungen;99 9.2.4;Menschliche Entwicklungsprozesse verstehen;104 9.3;Ethik, Werte und kritische Betrachtungen;110 9.3.1;Die Menschen sind in Ordnung (People are okay!);110 9.3.2;Jeder Mensch hat die Fähigkeit zu denken;110 9.3.3;Jeder Mensch kann über sein Handeln und sein Schicksal selbstentscheiden;111 9.3.4;Risiken;111 9.3.5;Kritik;113 9.4;Methodische Ansätze;115 9.4.1;Einsatzmöglichkeiten in S
eminaren und Trainings;116 9.4.2;Einsatzmöglichkeiten in Coachings;119 9.4.3;Einsatzmöglichkeiten in der Beratungsarbeit mit Teams undOrganisationen;123 9.5;Essenz und Bedeutung;125 9.5.1;Literatur;126 10;Konzept 4 Themenzentrierte Interaktion (TZI): Alles im Blick! TZI als Basis für partnerschaftliche Kommunikation in Systemen;128 10.1;Einführung und Geschichte;129 10.2;Was steckt dahinter?;130 10.2.1;Wesentliches zum Fundament der Themenzentrierten Interaktion;130 10.2.1.1;Humanistische Grundannahmen der TZI: die Axiome;130 10.2.1.2;Postulate der TZI;131 10.2.1.3;Die zwei Ebenen der Interaktion;132 10.2.1.4;Die vier Faktoren der TZI;133 10.3;Ethik, Werte und kritische Betrachtungen;135 10.3.1;Ethische und politische Verantwortung;135 10.3.2;Kritik und mögliche Risiken;136 10.4;Methodische Ansätze;137 10.4.1;Das Leitungsverständnis der TZI;137 10.4.2;Planen und Steuern von Seminaren mithilfe von TZI;140 10.4.3;Explizite Nutzung des TZI-Modells in Seminaren;145 10.4.4;Hilfsregeln der TZI;147 10.4.5;Grundsätzliches zur Planbarkeit von Seminaren;148 10.5;Essenz und Bedeutung;149 10.5.1;Alles im Blick!;149 10.5.2;TZI als Basis für partnerschaftliche Kommunikation in Systemen;150 10.5.3;Literatur und Adressen;150 11;Konzept 5 Neurolinguistisches Programmieren: Abenteuerland NLP NLP im Trainingsalltag;152 11.1;Einführung und Geschichte;153 11.2;Was steckt dahinter?;155 11.2.1;Konzepte für individuelles Lernen durch Erfahrung und mit allen Sinnen;155 11.2.2;NLP die Annahmen;156 11.3;Ethik, Werte und kritische Betrachtungen;158 11.3.1;Ethik und Werte;158 11.3.2;Kritikpunkte;160 11.4;Methodische Ansätze;162 11.4.1;Die Werkzeuge des NLP;162 11.4.1.1;Rapport: Pacing und Leading;163 11.4.1.2;Die B.A.G.E.L.-Methode;164 11.4.1.3;Repräsentationssysteme (VAKOG);165 11.4.1.4;Sprachmodelle;167 11.4.1.5;Metaprogramme;169 11.4.1.6;Der NLP-Zielfindungsprozess;170 11.4.1.7;Das Konzept der Neurologischen Ebenen;172 11.4.1.8;Reframing;174 11.4.1.9;Anwendungsgebiete für die Neurologischen
Ebenen;175 11.4.1.10;Weitere Anwendungsbereiche von NLP-Werkzeugen;178 11.5;Essenz und Bedeutung;179 11.5.1;Literatur und Adressen;180 12;Konzept 6 Gestaltansatz: Vordergründig Hintergründiges Der Gestaltansatz als Haltung und Anleitung;182 12.1;Einführung und Geschichte;183 12.2;Was steckt dahinter?;185 12.2.1;Kernbegriffe, Theorie und Gesetze;185 12.2.1.1;Kernbegriffe des Gestaltansatzes;185 12.2.1.2;Paradoxe Theorie der Veränderung;192 12.3;Ethik, Werte und kritische Betrachtungen;194 12.3.1;Wahlfreiheit als Ziel: Der mündige Mensch;194 12.3.2;Kritische Betrachtungen: Gestaltwerdung im Zeitplan?;195 12.4;Methodische Ansätze;196 12.4.1;Methoden und Beispiele;197 12.4.2;Weitere Instrumente für Training, Beratung und Coaching;199 12.5;Essenz und Bedeutung;201 12.5.1;Literatur und Adressen;203 13;Konzept 7 Psychodrama: Vorhang auf und Bühne frei! Schönste aller Therapien;204 13.1;Einführung und Geschichte;205 13.2;Was steckt dahinter?;207 13.2.1;Die schönste aller Therapien;207 13.2.1.1;Psychodramatiker sind Regisseure, Therapeuten und Gruppendynamiker;207 13.2.1.2;Wie kommt das Innen nach außen?;207 13.2.1.3;Kein Als-ob, sondern Wirklichkeit;208 13.2.1.4;Spielendes Erzählenverändert Wahrnehmen;210 13.3;Ethik, Werte und kritische Betrachtungen;213 13.3.1;Kritik;215 13.4;Methodische Ansätze;216 13.4.1;Klassische psychodramatische Gruppenmethode: das aktionssoziometrische Standbild arbeiten an der Gruppe;216 13.4.2;Weiterentwicklungen psychodramatischer Methoden für das Lernen in Organisationen;218 13.4.3;Reality Training;221 13.4.4;Soziodramatische Lehrstücke ins Buch eintauchen;223 13.4.5;Dynamisierende Lernkonzepte für Großgruppen in Organisationen;228 13.5;Essenz und Bedeutung;233 13.5.1;Literatur und Adressen;234 14;Konzept 8 Handlungslernen: Training by Doing Die Grundlagen modernen Handlungslernens;236 14.1;Einführung und Geschichte;237 14.2;Was steckt dahinter?;239 14.2.1;Die Basis modernen Handlungslernens: Hintergründe und Lernmodelle;239 14.2.1.1;Definition
Handlungslernen;239 14.2.1.2;Definition Erlebnispädagogik;240 14.2.1.3;Das 4-Schritte-Modell für wirkungsvolles Handlungslernen;241 14.2.1.4;Handlungslernen und andere Lernmodelle;242 14.3;Ethik, Werte und kritische Betrachtungen;248 14.3.1;Das ethische Fundament und die Werte;248 14.3.2;Gefahren;249 14.3.3;Die Transferproblematik;250 14.3.4;Just for fun und Action Hopping;251 14.3.5;Insellage und Backhome-Situationen;252 14.3.6;Der Sicherheitsaspekt beim Handlungslernen;253 14.4;Methodische Ansätze;254 14.4.1;Outdoortraining;254 14.4.2;Management by Nature;255 14.4.3;Lernprojekte;256 14.4.4;Seilgärten;257 14.4.5;Vertrauensübungen;259 14.4.6;Wahrnehmungsschulung;259 14.4.7;City Bound;260 14.4.8;Reflexionsmethoden;261 14.4.9;Metaphern;264 14.5;Essenz und Bedeutung;266 14.5.1;(Handlungs-)Lernen von Schüsselqualifikationen;267 14.5.2;Literatur und Adressen;268 15;Konzept 9 Konstruktivismus: Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Konstruktivistische Prämissen und ihre Bedeutung in der Bildungs- und Beratungsarbeit;270 15.1;Einführung und Geschichte;271 15.2;Was steckt dahinter?;274 15.2.1;Konstruktivistische Grundpositionen im Überblick;274 15.2.1.1;Wie können wir erkennen?;274 15.2.1.2;Grundpositionen des radikalen Konstruktivismus;275 15.2.1.3;Konstruktivismus aus der Sicht der Gehirnforschung;276 15.2.1.4;Die Bedeutung passfähiger Konstrukte;277 15.3;Ethik, Werte und kritische Betrachtungen;278 15.3.1;Zwischen verlorener Orientierung und gewonnener Freiheit;278 15.3.2;Beliebigkeit;280 15.3.3;Konstruktivistische Arroganz;281 15.4;Methodische Ansätze;282 15.4.1;Die Kunstinterpretation;282 15.4.2;Der magische Stab;284 15.4.3;Der Vehikelbau;285 15.4.4;Der Baum ist das Ziel;286 15.4.5;Zwei Seilfiguren;286 15.4.6;Kognitive Landkarten entwerfen;288 15.4.7;Der Spatz in der Hand;289 15.4.8;Verdecktes Coaching;290 15.4.9;Die Abstraktionsleiter;291 15.5;Essenz und Bedeutung;293 15.5.1;Literatur;295 16;Konzept 10 Systemtheorie: Was brauchbar ist, entscheide ich! Der systemische Ansa
tz als Grundhaltung;296 16.1;Einführung und Geschichte;297 16.2;Was steckt dahinter?;300 16.2.1;Von Systemen, ihren Umfeldern und den Dingen, die man beobachten kann;300 16.2.1.1;Das soziale System und seine Grenze: die Innensicht;300 16.3;Das System und sein Umfeld;302 16.4;Das Beobachten von Systemen;305 16.5;Ethik, Werte und kritische Betrachtungen;307 16.5.1;Systemtheorie lässt sich schwer in ethische Begriffe fassen;307 16.5.2;Koexistenz als ethisches Paradigma in der Systemtheorie;308 16.5.3;Die Ethik einer systemischen Grundhaltung in Training und Beratung;309 16.5.4;Risiken und Kritik;310 16.6;Methodische Ansätze;312 16.6.1;Feedback;312 16.6.2;Systemisches Fragen;315 16.6.3;Paradoxe Interventionen;316 16.6.4;Aufstellungsarbeit mit Systemen;317 16.6.5;Rekonstruktion von Kausalfaktoren;320 16.6.6;Kulturanalyse;321 16.6.7;Tetralemma-Methode;324 16.6.8;Systemisches Malen Picasso hilf;325 16.7;Essenz und Bedeutung;326 16.7.1;Bedeutung der Systemtheorie für Training und Beratung;327 16.7.2;Literatur;329 17;Konzept 11 Lösungsorientierte Kurztherapie (Solution Focused Brief Therapy nach Steve de Shazer und Insoo Kim Berg) Lösungen (er)finden, Ressourcen und Stärken nutzbar machen;330 17.1;Einführung und Geschichte;331 17.1.1;Vom Problem-Lösen zum Lösungen-Finden;331 17.2;Was steckt dahinter?;334 17.2.1;Über Familien- und Systemtheorie, Hypnotherapie sowie den Gebrauch von Sprache;334 17.2.1.1;Die Hypnotherapie von Milton Erickson;334 17.2.1.2;Haltung und Grundannahmen aus der Familien- und Systemtherapie;336 17.2.1.3;Zur Bedeutung von Sprache und deren Gebrauch;337 17.3;Ethik, Werte und kritische Betrachtungen;340 17.3.1;Lehrsätze der lösungsorientierten Kurztherapie;340 17.3.2;Lösungsorientierung: Haltung oder Technik?;341 17.3.3;Klienten als Experten für sich selbst;342 17.3.4;Kritische Betrachtungen: Grenzen in der Anwendung;342 17.4;Methodische Ansätze;346 17.4.1;Darum geht es;346 17.4.2;Lösungsorientierte Gesprächsführung;348 17.4.3;Auftragsklärung;349 17.4.4;A
nerkennung, Komplimente, wertschätzende (positive) Konnotation;350 17.4.5;Beziehungsgestaltung und Intervention;352 17.4.6;Unverbindliche Beziehung zwischen Besucher und Praktiker;352 17.4.7;Suchende Beziehung zwischen Klagendem und Praktiker;354 17.4.8;Consultingbeziehung zwischen Kunde und Praktiker;357 17.4.9;Expertenbeziehung zwischen Kunde und Praktiker;357 17.4.10;Die Wunderfrage, Orientierung auf die Zukunft;358 17.4.11;Weitere Interventionsmöglichkeiten;360 17.4.12;Ziel- und Lösungsformulierung;365 17.4.13;Vom Widerstand zur Kooperation;367 17.5;Essenz und Bedeutung;368 17.5.1;Welche Bedeutung hat lösungsorientiertes Arbeiten für Bildung,Training und Beratung?;368 17.5.2;Literatur und Adressen;370 18;Konzept 12 Der Provokative Stil Humor und Provokation in Therapie, Coaching und Beratung;372 18.1;Einführung und Geschichte;373 18.2;Was steckt dahinter?;375 18.2.1;Die Bedeutung der Emotionen;375 18.2.1.1;Provokation und Humor als Basis des Provokativen Stils;376 18.2.1.2;Der Fokus auf die Stärken des Klienten;377 18.2.2;Ethik, Werte und kritische Betrachtungen;379 18.2.2.1;Humor in der Therapie;379 18.2.2.2;Die Persönlichkeit des Anwenders;380 18.2.2.3;Provokation als Manipulation;381 18.2.2.4;Ethische Grundsätze;381 18.3;Methodische Ansätze: Einige Werkzeuge desProvokativen Stils;382 18.3.1;Die Provokation des Widerstands;382 18.3.2;Unterstellungen, Behauptungen und Begeisterung für das Symptom;382 18.3.3;Pauschalierungen oder: Rollentausch zwischen Berater und Klient;383 18.3.4;Idiotische Ratschläge;384 18.3.5;Die Authentizität des Beraters;384 18.4;Essenz und Bedeutung;387 18.4.1;Literatur und Adressen;388 19;Anhang;389 19.1;Die Autorinnen und Autoren;390 19.2;Stichwortverzeichnis;393