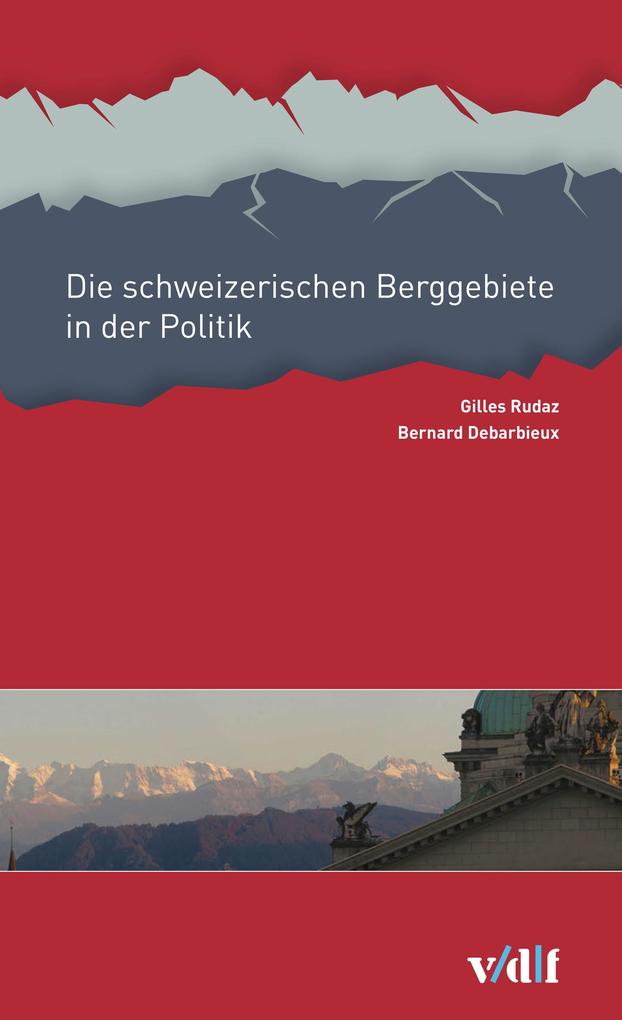
Sofort lieferbar (Download)
Die Berge sind seit über 150 Jahren ein bedeutendes Thema in der Schweizer Politiklandschaft. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts prägen sie massgeblich das Nationalbewusstsein, stellen eine wichtige touristische Ressource dar und waren insbesondere seit den 1920er-Jahren viele Male Gegenstand der öffentlichen Politik sowie unzähliger Kontroversen.
Dieses Buch gibt einen Überblick über die verschiedenen Formen der Politisierung der Berge in der Schweiz. Die Initiativen zur Waldbewirtschaftung im 19. Jahrhundert finden ebenso Aufmerksamkeit wie Massnahmen, die zwischen den beiden Weltkriegen zugunsten der Bergbevölkerung getroffen wurden. Doch auch und vor allem aktuelle Themen stehen im Mittelpunkt:
etwa die Alpenkonvention, die TransJurassische Konferenz, Initiativen zum alpenquerenden Verkehr oder zu Zweitwohnungen sowie der Anfang des neuen Jahrtausends einsetzende tief greifende Wandel in der Regional-, Agrar- und Umweltpolitik. Zu einem Zeitpunkt, da auf Bundesebene immer mehr Raum für neue Betrachtungen besteht, vermittelt dieses Buch die nötigen Kenntnisse zum Umgang der Schweizer Politik mit dem Thema Berge.
Dieses Buch gibt einen Überblick über die verschiedenen Formen der Politisierung der Berge in der Schweiz. Die Initiativen zur Waldbewirtschaftung im 19. Jahrhundert finden ebenso Aufmerksamkeit wie Massnahmen, die zwischen den beiden Weltkriegen zugunsten der Bergbevölkerung getroffen wurden. Doch auch und vor allem aktuelle Themen stehen im Mittelpunkt:
etwa die Alpenkonvention, die TransJurassische Konferenz, Initiativen zum alpenquerenden Verkehr oder zu Zweitwohnungen sowie der Anfang des neuen Jahrtausends einsetzende tief greifende Wandel in der Regional-, Agrar- und Umweltpolitik. Zu einem Zeitpunkt, da auf Bundesebene immer mehr Raum für neue Betrachtungen besteht, vermittelt dieses Buch die nötigen Kenntnisse zum Umgang der Schweizer Politik mit dem Thema Berge.
Inhaltsverzeichnis
1;Titelseite;1 2;Impressum;4 3;Vorwort;7 3.1;Die wandelnde Rolle der Berggebiete in der schweizerischen Politik;7 3.2;Das Berggebiet in der schweizerischen Politik;9 4;Danksagungen;11 5;Inhaltsverzeichnis;13 6;Kapitel 1: Die Berggebiete eine politische Angelegenheit;15 7;Kapitel 2: Die Berggebiete im Selbstverständnis der Schweiz;17 7.1;Die Triebfedern des Schweizer Selbstbildes;18 7.2;Der Bergbewohner als nationale Symbolfigur;22 7.3;Die Berggebiete als Staatsfrage;25 8;Kapitel 3: Die Berggebiete in der öffentlichen Politik;29 8.1;Die Alpen unter Oberaufsicht;29 8.2;Die Lebensbedingungen in den Berggebieten verbessern;33 8.3;Die Landwirtschaft im Zentrum der Aufmerksamkeit;36 8.4;IHG eine umfassende Politik für die Berggebiete;40 9;Kapitel 4: Die Berggebiete heute neu überdacht;45 9.1;Die neue Regionalpolitik: ein projektbezogener Ansatz;45 9.2;Landwirtschaft: Projektbezogenheit und Multifunktionalität;49 9.3;Forstpolitik: Wendepunkt der Multifunktionalität;55 9.4;Natur und Landschaft schützen;57 9.5;Raumplanung;59 9.6;Tourismus: eine wirtschaftliche Ressource von nationaler Bedeutung;61 9.7;Energie: der grüne Akku des Landes;63 9.8;Die Entwicklung von institutioneller Vernetzung und Partnerschaften;65 9.9;Die Berggebiete im Wandel;67 10;Kapitel 5: Gemeinsamkeiten, Kontroversen und Diskrepanzen;69 10.1;Der aussergewöhnliche Konsens in den Jahren 1930 bis 1940;69 10.2;Diskussion um das Gleichgewicht im Schweizer Territorium;72 10.3;Porta Alpina: Begleiterscheinung oder Sinnbild?;74 10.4;Entstehung einer kulturellen Kluft?;76 10.5;Institutionelles Gleichgewicht und Verhandlungskultur;78 10.6;Aktuelle Spannungen und vehemente Stellungnahmen;81 10.7;Hinterfragung der Besonderheit der Berggebiete;88 10.8;Neue Feststellungen formulieren? Neue Initiativen auf den Weg bringen?;90 11;Kapitel 6: Gebirge ohne Grenzen?;93 11.1;Mauern und Brücken am Rande des Territoriums;93 11.2;Die alpine Zusammenarbeit: Ziele und Chancen;97 11.3;Die Boykottierung der Alpenkonvention durch di
e Schweiz;99 11.4;Umstrukturierung der Kräfte rund um die Alpen?;102 11.5;Das Juramassiv und die Förderung einer gemeinsamen Identität;106 11.6;Das europäische Gebirge und die EU-Politik;108 11.7;Die Schweiz und die Berge der Welt;114 11.8;Eine diplomatische Strategie;116 11.9;Zusammenarbeit zwischen den Berggebieten;118 12;Kapitel 7: Die schweizerischen Berggebiete am Scheideweg?;121 13;Das schweizerische Berggebiet in der Politik: Chronologie;125 14;Bibliografie;127 15;Die Autoren;133
e Schweiz;99 11.4;Umstrukturierung der Kräfte rund um die Alpen?;102 11.5;Das Juramassiv und die Förderung einer gemeinsamen Identität;106 11.6;Das europäische Gebirge und die EU-Politik;108 11.7;Die Schweiz und die Berge der Welt;114 11.8;Eine diplomatische Strategie;116 11.9;Zusammenarbeit zwischen den Berggebieten;118 12;Kapitel 7: Die schweizerischen Berggebiete am Scheideweg?;121 13;Das schweizerische Berggebiet in der Politik: Chronologie;125 14;Bibliografie;127 15;Die Autoren;133
Produktdetails
Erscheinungsdatum
01. August 2014
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
135
Dateigröße
1,79 MB
Autor/Autorin
Gilles Rudaz, Bernard Debarbieux
Herausgegeben von
SAB Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
französisch
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Produktart
EBOOK
Dateiformat
PDF
ISBN
9783728136053
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Die schweizerischen Berggebiete in der Politik" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.








