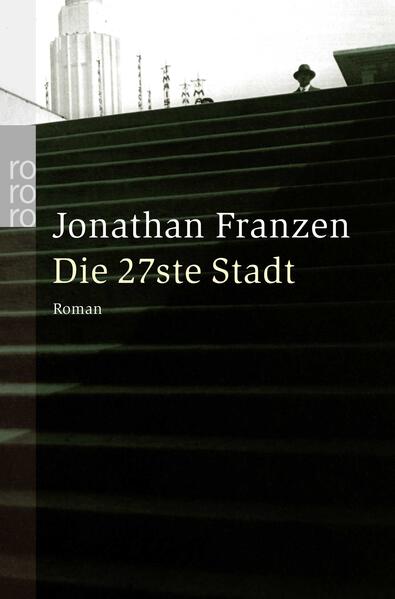
Zustellung: Di, 02.09. - Do, 04.09.
Versand in 2 Tagen
VersandkostenfreiSt. Louis, die einst blühende Stadt im Mittelwesten Amerikas, bekommt einen neuen Polizeichef. Es ist S. Jammu, eine Frau aus Indien: zart, jung, sympathisch. Doch kaum hat sie ihr Amt angetreten, greift Gewalt um sich. Eine Bombe explodiert. Auch Martin Probst, Erbauer des städtischen Wahrzeichens "The Arch", und seine Frau Barbara - das Vorzeige-Ehepaar, von vielen um sein Glück beneidet - erleben Gefahr, süße Verlockungen und Angst.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
01. März 2005
Sprache
deutsch
Untertitel
Roman.
Originaltitel: The Twenty-Seventh City.
3. Auflage.
Auflage
3. Auflage
Seitenanzahl
670
Reihe
rororo Taschenbücher
Autor/Autorin
Jonathan Franzen
Übersetzung
Heinz Müller
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Produktart
kartoniert
Gewicht
731 g
Größe (L/B/H)
190/125/46 mm
ISBN
9783499238727
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Atemlos ist das zu lesen. Ein Roman von epischer Wucht. FAZ. NET
Hochspannung pur. Welt am Sonntag
Man tut sich schwer, den Roman überhaupt einmal aus der Hand zu legen. Neue Zürcher Zeitung
Hochspannung pur. Welt am Sonntag
Man tut sich schwer, den Roman überhaupt einmal aus der Hand zu legen. Neue Zürcher Zeitung
Bewertungen
am 24.12.2007
Die 27ste Stadt
Der Roman soll Thriller, Sittengemälde, Zeitbild und Literatur in einem sein. Vor allem fehlt ihm die Spannung. Es wird zu viel ausgeschrieben, beschrieben, charakterisiert. Wir werden mit Details überhäuft. Da ist weniger oft mehr. Die Realität wird im Genre des Kriminalromans und Thrillers zupackender, kürzer mit Offenlassungen präsentiert, die dem Leser Raum geben. Jonathan Franzen erschafft nicht nur in S. Jammu keine überzeugende Polizeichefin, der Roman schleppt auch andere Figuren als Ballast mit sich herum, die geheimnisvoll wirken sollen, aber blass bleiben. Sie sind oft nicht durch sich selbst präsent, sondern über das, was über sie erzählt, als Hintergrundinformation geliefert wird. Der Plot ist über knapp 670 Seiten gestreckt, und wie bei Suppen, denen irgendwann so viel Wasser zugefügt wurde, dass man das Herzhafte nicht mehr schmeckt, weiß man als Leser irgendwann, was dem Autor am Herzen liegt, und würde ihm wünschen, es kürzer zu fassen. In der Substanz ist Franzen sicher ein Spiegelbild der amerikanischen weißen Mittelschicht der achtziger Jahre gelungen, doch gibt er allzu oft der Sprache nach, was einer fesselnden Schilderung der Geschichte im Wege steht. Es tauchen zu viele Figuren auf, zu viele Orte, zu viele Nebenschauplätze und die Wahl einer indischen Polizeichefin überzeugt auch nicht, nicht mal wenn der Einfall am Anfang stand und darum herum ein literarisches Gebäude errichtet werden sollte. Das Bemühen um tiefere Bedeutung ist allzu offensichtlich. Wer Franzens andere beiden auf Deutsch erschienen Romane mag, wird enttäuscht sein, obwohl sein Humor auch hier spärlich durchscheint und man dem Autor sicher nicht absprechen will, dass er schreiben kann. Der 27ste Stadt leidet an dem, was ihr aufgebürdet wurde.








