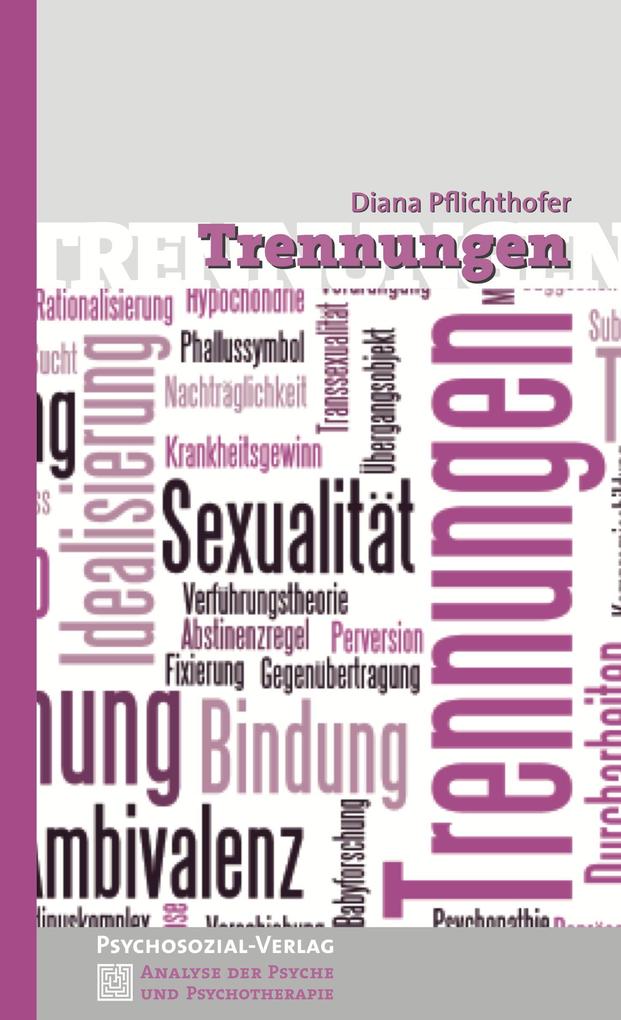Diana Pflichthofer untersucht Trennungen und ihre Bedeutung für die psychische Entwicklung in und außerhalb der Psychotherapie. Sie stellt dar, welche Bedeutung dem Begriff der Trennung in psychoanalytisch orientierten Theorien zukommt, und macht dabei deutlich, dass Trennungen nicht nur zu einem schmerzhaften Gefühl des Verlusts führen, sondern dass in ihnen auch der Wunsch nach Autonomie, die Angst vor Nähe oder das Bedürfnis, einer traumatischen Situation zu entfliehen, zum Ausdruck kommen können. Es wird gezeigt, dass Trennungen Bestandteil von Reifungs- und Entwicklungsprozessen sind, bei denen es immer auch um eine Loslösung von früheren Entwicklungsphasen und den mit ihnen verbundenen inneren Objekten geht.
Die Autorin beschäftigt sich sowohl mit Trennungskonflikten des Alltags als auch mit solchen, die Symptomcharakter erlangen, oder solchen, die in Traumatisierungen ihren Ursprung haben. An anschaulichen Fallbeispielen verdeutlicht sie, wie Trennungskonflikte in der Psychotherapie bearbeitet werden können.
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
Einleitung
Der Entstehungskontext des Begriffs »Trennung« und seine soziokulturellen Implikationen
Formen der Trennung
Trennungsgeschichte I der konflikthafte Wunsch nach Autonomie
Die Metamorphose von »Hänschen klein«
Zur Entstehung psychoanalytischer Trennungskonzepte
»Fort Da« Sigmund Freud
Trennungsgeschichte II traumatische Trennungserlebnisse
Ernest W. Freud ein Leben voller Objektverluste
Separation und Individuation Margaret S. Mahler
Differenzierung erste Subphase (4. /5. bis 12. Monat)
Übungsphase zweite Subphase (12. bis 18. Monat)
Wiederannäherung dritte Subphase (18. bis 24. Monat)
Konsolidierung vierte Subphase (24. bis 36. Monat)
Philobathie und Oknophilie Michael Balint
Die Philobaten scheinbar unabhängig und heroisch
Philobatische Szenen Kinder am Kilimandscharo
Die Oknophilen anklammernd und scheinbar hilflos
Oknophile Szenen Hänschen klein mit Tracking-App
Die Fähigkeit zum Alleinsein Donald W. Winnicott
Trennungskonflikte im Alltag
Der übervolle Schrank nichts weggeben können
Überlastung immer Ja sagen müssen
Mit dem Strom schwimmen »mitmachen müssen«
Trennungskonflikte in der klinischen Praxis
Indikatoren und Symptome
Schwellensituationen
Leitaffekte von Trennungskonflikten
Trennungsängste und Trennungswünsche
Trennungstraumata
Übergangsobjekte und Symbole
Introjekte
Trennung als Abwehr
Trennungskonflikte in der Psychotherapie
Trennungskonflikte von Therapeutinnen und Therapeuten
Trennungskonflikte in Übertragung und Gegenübertragung
Rahmen und Setting als Übertragungsauslöser Trennungsverbot und Unterwerfung
»Ausklammern« des Objekts
Trennungsangst und Objektsicherung
Therapeutische Aspekte bei Patienten mit traumatischen Trennungserfahrungen
Beendigung von Psychotherapien gehen können
Literatur