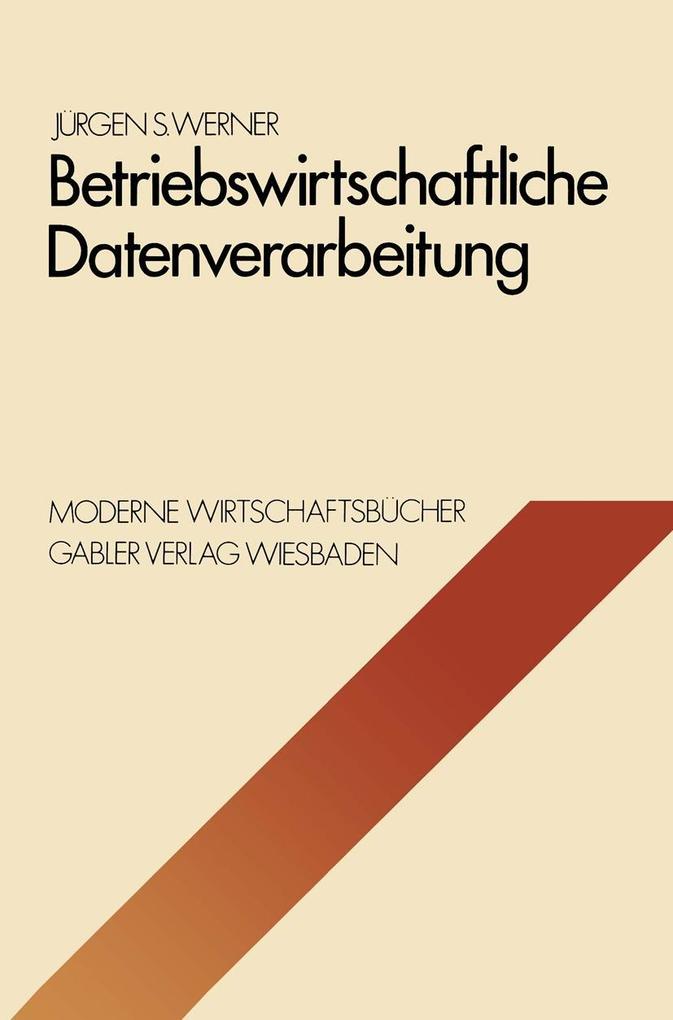
Sofort lieferbar (Download)
Inhaltsverzeichnis
Einführung. - Einführende Literatur. - Erstes Kapitel: Das Umfeld Die Betriebswirtschaft als System. - Lehr- und Lernziele. - I. Das System. - A. Der Systembegriff. - B. Komplexität von Systemen. - C. Die Systemstruktur. - II. Das System Betriebswirtschaft . - A. Die Produktivkräfte. - B. Steuerungsfunktionen. - III. Das betriebswirtschaftliche Sozialsystem. - A. Die Person innerhalb des betriebswirtschaftlichen Sozialsystems. - B. Die soziale Rolle. - C. Das Sozialsystem: Überblick. - D. Die Kleingruppe. - 1. Bedeutung der Kleingruppe. - 2. Merkmale einer Gruppe. - 3. Funktion der Gruppe. - 4. Das Leitsystem der Gruppe. - 5. Struktur der Kleingruppe. - 6. Die Leistungen der Gruppe. - 7. Informelle Gruppen. - E. Wirkungszusammenhang des betriebswirtschaftlichen Sozialsystems. - 1. Gruppen innerhalb des betriebswirtschaftlichen Sozialsystems. - 2. Mengentheoretische Aussagen. - 3. Das Ganze des betriebswirtschaftlichen Sozialsystems. - Zusammenfassung. - Übungsfragen zum Ersten Kapitel. - Literatur zum Ersten Kapitel. - Zweites Kapitel: Informationen und betriebswirtschaftliche Daten. - Lehr- und Lernziele. - I. Die Grundlage: Die neue Kategorie der Information. - A. Das mathematische Maß für die Information. - 1. Der Informationsbegriff. - 2. Die Umkehrung der mathematischen Wahrscheinlichkeit. - 3. Der Informationsgehalt. - 4. Verlauf des 2-er Logarithmus als Ausdruck des Informationsgehalts. - B. Die subjektive Information. - II. Der kybernetische Regelkreis der Kommunikation. - A. Subjektive Information und Kommunikation. - B. Der kybernetische Regelkreis. - 1. Der Regelkreis der Kommunikation. - 2. Die Steuerung. - 3. Die Regelung. - C. Die Bedeutung des kybernetischen Regelkreises in der betriebswirtschaftlichen Praxis. - III. Die Begriffsbildung. - A. Bedeutung und Definition. - B. Begriffssysteme. - C. Zweck der klaren Begriffsbildung. - D. Betriebswirtschaftliche Bedeutung der Begriffsbildung. - IV. Betriebswirtschaftliche Daten. - A. Informationen und Daten. - B. Betriebswirtschaftliche Daten. - V. Kommunikationsgefüge innerhalb des betriebswirtschaftlichen Informationssystems. - Zusammenfassung. - Übungsfragen zum Zweiten Kapitel. - Literatur zum Zweiten Kapitel 71. - Drittes Kapitel: Wichtige Prinzipien und Möglichkeiten der Datenverarbeitung. - Lehr- und Lernziele. - I. Das Ziel: EDV -unterstützte Informationssysteme. - II. Spezialisierung (Arbeitsteilung) der EDV. - A. Das Kanalprinzip. - B. Die SPOOL-Funktion. - III. Das Speichern und Wiederfinden von Daten. - A. Externe Datenspeicher (Überblick). - B. Datenorganisation und Datenzugriff. - 1. Merkmale der Magnetband-und Magnetplattenspeicher. - 2. Die Index-sequentielle Speicherorganisation. - 3. Das Massenspeicher-System (MSS). - 4. Speicherhierarchie. - IV. Virtueller (Hauptspeicher (VS). - A. Das Problem: Begrenzter realer Hauptspeicher. - B. Arbeitsweise des virtuellen Speichers. - 1. Virtueller und realer Hauptspeicher. - 2. Adressenumsetzung des virtuellen Speichers. - V. Datenfernverarbeitung (DFV). - A. Telefon und/oder Datenfernverarbeitung? . - B. Hardware-Funktionen der Datenfernverarbeitung 94. - C. Die Steuerung der Datenfernverarbeitung. - D. Einsatzmöglichkeiten der Datenfernverarbeitung. - E. Ausblick: Computer am Arbeitsplatz. - Zusammenfassung. - Übungsfragen zum Dritten Kapitel. - Literatur zum Dritten Kapitel. - Viertes Kapitel: Die Datenbank im Mittelpunkt EDV-gestützter Informationssysteme. - Lehr- und Lernziele. - I. Die Daten in einer Datenbank. - II. Wichtige Grundbegriffe einer Datenbank (DB). - A. Definition der Datenbank. - B. Formatierte und Nicht-formatierte DB. - 1. Formatierte DB. - 2. Nicht-formatierte DB. - C. Datenelemente und -felder. - 1. Das Datenelement. - 2. Das Datenfeld. - D. Die Datenbank-Struktur. - III. Das Relationenmodell. - IV. Die Kettstruktur. - A. BOMP. - B. Ablauf. - V. Die Hierarchische Datenbank-Struktur. - A. Das IMS ein hierarchisch strukturiertes Datenbank-/Datenkommuni-kations (DB/DC)-System. - B. Anwendungsprogrammierung und DB-Aufbau. - C. Die Beziehungen zwischen den Segmenten. - D. Sensitivität von Segmenten. - E. Die Zugriffsmethoden. - F. Logische DB-Struktur und Einrichtungen. - 1. Der Begriff logisch . - 2. Logische Datenstrukturen und logische Datenbanken. - G. Sekundär-Indices. - H. Datenkommunikationseinrichtungen des IMS. - 1. Das logische Datennetz. - 2. Arbeitsweise der Datenkommunikation. - 3. Abfragesprache. - I. Lehr- und Lernhilfe an der Datenstation. - Zusammenfassung. - Übungsfragen zum Vierten Kapitel. - Literatur zum Vierten Kapitel. - Fünftes Kapitel: Systemanalyse und Systemplanung. - Lehr- und Lernziele. - I. Der Mensch als wichtigster Bezugspunkt des Organisationsgefüges. - A. Der Anknüpfungspunkt: Die Arbeit des Systemanalytikers. - B. Die Person in der betriebswirtschaftlichen Organisation. - C. Die gegenwärtige Situation. - D. Konsequenzen für die Organisationsgestaltung. - 1. Die Voraussetzungen für ansprechende Arbeitsbedingungen. - 2. Der Mitarbeiter als Bezugspunkt. - II. Die betriebswirtschaftliche Organisation und die Systemanalyse. - A. Die Organisation als System. - B. Die Rolle der Datenverarbeitung. - C. Die Problemanalyse. - III. Die Analyse des Ist-Zustandes. - A. Zweck, Inhalt und Umfang. - B. Vorgehensweisen (Informationsbeschaffung). - 1. Bestandsaufnahme (Inventur). - 2. Interviews. - 3. Fragenbogen. - 4. Beobachtungen. - C. Entscheidungstabellen. - 1. Ein Beispiel: Regulierung Lieferantenrechnungen. - 2. Definition der Entscheidungstabelle. - 3. Typen (Arten) der Entscheidungstabellen. - D. Informationsbedarfsanalyse. - 1. Operative Informationen. - 2. Führungsinformationen. - 3. Der Systemanalytiker wirkt wie ein Katalysator . - IV. Soll-Konzept-Entwicklung. - A. Grobplanung. - 1. Umsetzung von Informationen in Daten. - 2. Die HIPO-Technik. - 3. Die schrittweise Entwicklung des Soll-Konzepts. - 4. Möglichkeiten der HIPO-Technik. - 5. Ein HIPO-Beispiel. - 6. Personelle und persönliche Möglichkeiten. - B. Feinplanung des neuen Systems. - 1. Umfang des Begriffs Feinplanung . - 2. Die Systemausgabe. - 3. Die Anwendungssimulation. - C. Die Programmierung. - 1. Die Aufgabe des Programmierers. - 2. Die bisherige Praxis: Programmierung als handwerkliche Kunst. - 3. Moderne Programmiermethoden und -vorgehensweisen. - 4. Dialogsprachen für die Fachabteilung. - 5. Lizensierte Anwendungsprogramme. - V. Die Durchführung der EDV-Organisationsumstellung. - A. Die Projektorganisation. - B. Die Entwicklungsstufen der Organisationsdurchführung. - 1. (Re-) Organisationsidee. - 2. Überlegung des Organisationsvorhabens. - 3. Ist-Zustandsanalyse und Grob-Sollkonzept-Entwicklung. - 4. Feinplanung. - 5. Programmierung und Datenbankerstellung. - 6. Tests. - 7. Einführung. - 8. Wartung. - C. Die Planung des Projektfortschritts. - 1. Die Problematik. - 2. Die Zeitplanung. - 3. Die Personalplanung. - 4. Planung und Kontrolle im kybernetischen Regelkreis. - 5. Projektfortschrittsmeldungen. - 6. Projekt-Mitarbeiter Meldungen. - 7. Bewertung der Projektfortschrittsberichte und Möglichkeiten. - 8. Netzpläne. - Zusammenfassung. - Übungsfragen zum Fünften Kapitel. - Literatur zum Fünften Kapitel. - Sechstes Kapitel: Das Ergebnis die Beurteilung der EDV. - Lehr- und Lernziele. - I. Die Begründung des EDV-Einsatzes. - A. Die gebotene kritische Grundhaltung des Betriebswirts. - B. Die menschlich-sozialen Auswirkungen der EDV. - C. Die volkswirtschaftliche Bedeutung der EDV. - D. Der betriebswirtschaftliche Nutzen der EDV. - II. Die Wirtschaftlichkeit der EDV. - A. Die Kosten der EDV. - 1. Umstellungskosten. - 2. Laufende Kosten. - B. Der Nutzen der EDV. - 1. Definition. - 2. Konkret feststellbarer Nutzen. - 3. Grob geschätzter Nutzen. - 4. Nutzenanalyse. - C. Wirtschaftlichkeitsrechnungen (Investitionsrechnungen). - 1. Ein Beispiel: Kauf oder Miete. - 2. Wichtige statische und dynamische Investitionsrechnungsverfahren. - 3. Barwert-Rechnung und Interne Zinsfuß-Methode. - 4. Einfluß der Steuern auf die Wirtschaftlichkeit. - III. Die Risiken des EDV-Einsatzes. - A. Der Risikobegriff. - B. Die wichtigsten Risiken. - C. Subjektive Wahrscheinlichkeiten. - D. Die Risikoanalyse. - 1. Ein Beispiel. - 2. Beurteilung der Risikoanalyse. - Zusammenfassung. - Übungsfragen zum Sechsten Kapitel. - Literatur zum Sechsten Kapitel. - Verzeichnis der Abbildungen. - Stichwortverzeichnis.
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
09. März 2013
Sprache
deutsch
Untertitel
Systeme, Strukturen, Methoden, Verfahren, Entscheidungshilfen.
Dateigröße in MByte: 21.
Seitenanzahl
264
Dateigröße
21,37 MB
Reihe
Betriebswirtschaftliche Grundlagen
Autor/Autorin
Jürgen S. Werner
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Produktart
EBOOK
Dateiformat
PDF
ISBN
9783322854308
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Betriebswirtschaftliche Datenverarbeitung" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.














