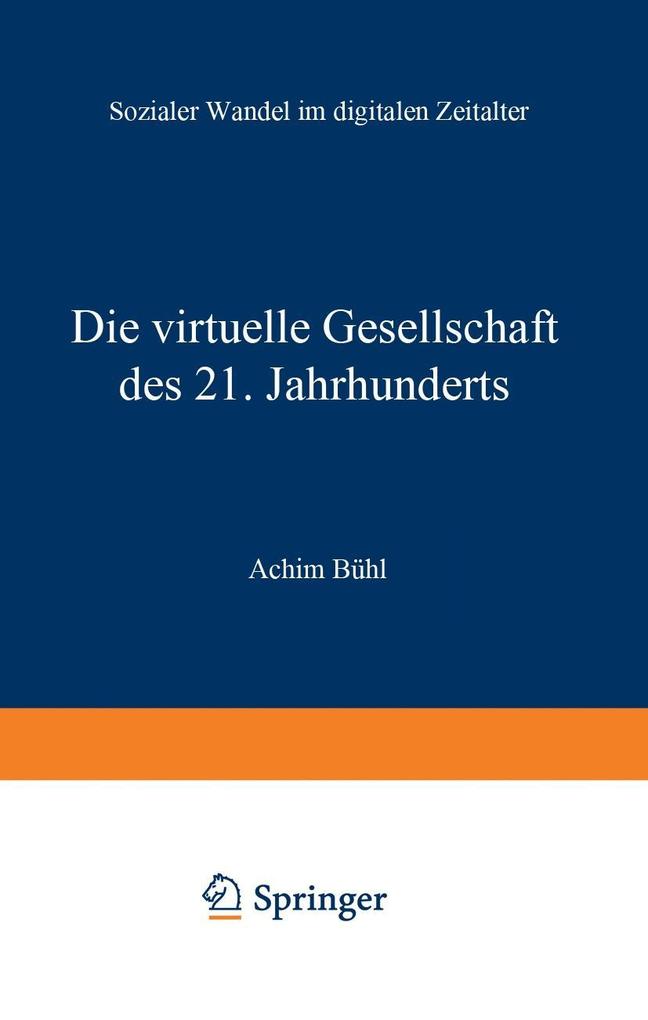Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Kapitell Die Theorie der virtuellen Gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1. 1 Metaphem im Kontext der globalen Vemetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1. 1. 1 Metapher Datenautobahn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1. 1. 2 Metapher Cyberspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1. 1. 3 Metapher digitale Stadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1. 1. 4 Metapher globales Dorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1. 1. 5 Metapher virtuelle Gemeinschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 1. 1. 6 Vergleichende Betrachtung der Metaphem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 1. 2 Gesellschaftsbegriffe im Zeitalter der Globalisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 1. 2. 1 Das Konzept der Infoanationsgesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 1. 2. 2 Das Konzept der WlSsensgesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 1. 2. 3 DasKonzept der Multioptionsgesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 1. 2. 4 Das Konzept der polyzentrischen Gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 1. 2. 5 Vergleichende Betrachtung der Gesellschaftsbegriffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 1. 3 Das Modell der virtuellen Gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 1. 3. 1 Phantomologischer Ursprung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 1. 3. 2 Der Begriff des Vtrtuellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 1. 3. 3 Charakteristika der virtuellen Gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 1. 4 Resümee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Kapitel2 Die Technologie der virtuellen Gesellschaft . . . . . . . . . . . . 100 2. 1 Synergetische Effekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 2. 2 Der modeme Rechner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 2. 3 Multimedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 2. 4 Die globale Vemetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 2. 5 Virtual Reality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 2. 5. 1 Begriffsdefinition Virtual Reality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 2. 5. 2 Vtrtual Reality als Paradigmenwechsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 2. 5. 3 VR-Grundtypen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 2. 5. 4 VR-Technik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 2. 6 Neuroinfoanatik und Neurobionik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 2. 7 Künsdiche Intelligenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 2. 7. 1 Historie der KI-Forschung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Inhal tsverzeichnis 6 2. 7. 2 KÜ11sdiche Intelligenz und Virtual Reality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 2. 8 ResÜlnee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Kapitel3 Die Ökonomie der virtuellen Gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . 147 3. 1 Konzentration lUld Monopolisiemng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inhaltsverzeichnis
1 Die Theorie der virtuellen Gesellschaft. - 1. 1 Metaphern im Kontext der globalen Vernetzung. - 1. 2 Gesellschaftsbegriffe im Zeitalter der Globalisierung. - 1. 3 Das Modell der virtuellen Gesellschaft. - 1. 4 Resümee. - 2 Die Technologie der virtuellen Gesellschaft. - 2. 1 Synergetische Effekte. - 2. 2 Der moderne Rechner. - 2. 3 Multimedia. - 2. 4 Die globale Vernetzung. - 2. 5 Virtual Reality. - 2. 6 Neuroinformatik und Neurobionik. - 2. 7 Künsdiche Intelligenz. - 2. 8 Resümee. - 3 Die Ökonomie der virtuellen Gesellschaft. - 3. 1 Konzentration und Monopolisierung. - 3. 2 Virtuelles Unternehmen. - 3. 3 Virtuelle Distribution. - 3. 4 Virtuelles Produkt. - 3. 5 Virtuelles Geld. - 3. 6 Virtuelle Betriebsorganisation. - 3. 7 Resümee. - 4 Die Sozialstruktur der virtuellen Gesellschaft. - 4. 1 Das Ende der Arbeit. - 4. 2 Politische Soziologie der sozialen Ungleichheit. - 4. 3 Sektorale Strukturveränderungen. - 4. 4 Umbruch des Wertschöpfungssystems. - 4. 5 Entwicklungstendenzen der Erwerbsarbeit. - 4. 6 Prognostizierter Arbeitsplatzabbau. - 4. 7 Veränderungen in der Qualifikationsstruktur. - 4. 8 Wandel des Qualifikationsbegriffs. - 4. 9 Die Visualisierung der Sozialstruktur. - 4. 10 Resümee. - 5 Politik und Öffentlichkeit der virtuellen Gesellschaft. - 5. 1 Die Krise des Nationalstaates. - 5. 2 Die elektronische Demokratie. - 5. 3 Reale Macht und virtuelle Herrschaft. - 5. 4 Online-Verfügungsgewalt. - 5. 5 Resümee. - 6 Das Recht der virtuellen Gesellschaft. - 6. 1 Rechtliche Aspekte der Virtualisierung. - 6. 2 Das Telekommunikationsrecht. - 6. 3 Das Urheberrecht. - 6. 4 Das Arbeits- und Sozialrecht. - 6. 5 Vertragsrecht und Verbraucherschutz. - 6. 6 Datenschutz und Datensicherheit. - 6. 7 Resümee. - 7 Die Ökologie der virtuellen Gesellschaft. - 7. 1 Euphorische Gnindstimmungen versus Katastrophenszenarien. - 7. 2 Steigender Konsum steigenderRessourcenverbrauch. - 7. 3 Verkürzung der Produkdebensdauer. - 7. 4 Die Problematik der Entsorgung. - 7. 5 Hoher Rohstoff- und Materialbedarf. - 7. 6 Umweltbelastungen durch Outsourcing . - 7. 7 Virtuell stimulierte Bedürfnisse. - 7. 8 Telematische Verkehrsbelastung. - 7. 9 Elektrosmog als Risikofaktor. - 7. 10 Ökologische Informatisierung. - 7. 11 Resümee. - 8 Die Kultur der virtuellen Gesellschaft. - 8. 1 Bild und Abbild. - 8. 2 Raum und Zeit. - 8. 3 Geist und Körper. - 8. 4 Geschwindigkeit und Stillstand. - 8. 5 Resümee. - 9 Das Geschlechterverhältnis der virtuellen Gesellschaft. - 9. 1 Genderspezifische Technikaneignung. - 9. 2 Technikmythos und Computerkultur. - 9. 3 Reorganisation der Arbeitsverhältnisse. - 9. 4 Neustrukturierung der Öffendichkeit. - 9. 5 Virtueller Geschlechtertausch. - 9. 6 Internet-Pornographie. - 9. 7 Resümee. - 10 Das Individuum der virtuellen Gesellschaft. - 10. 1 Das fragmentierte Subjekt. - 10. 2 Das öffendiche Subjekt. - 10. 3 Das be2iehungslose Subjekt. - 10. 4 Resümee. - Abschließende Betrachtung. - Anhang A Abbildungsverzeichnis. - Anhang B Tabellenverzeichnis. - Anhang C Literaturverzeichnis. - Anhang D Sach- und Personenregister.