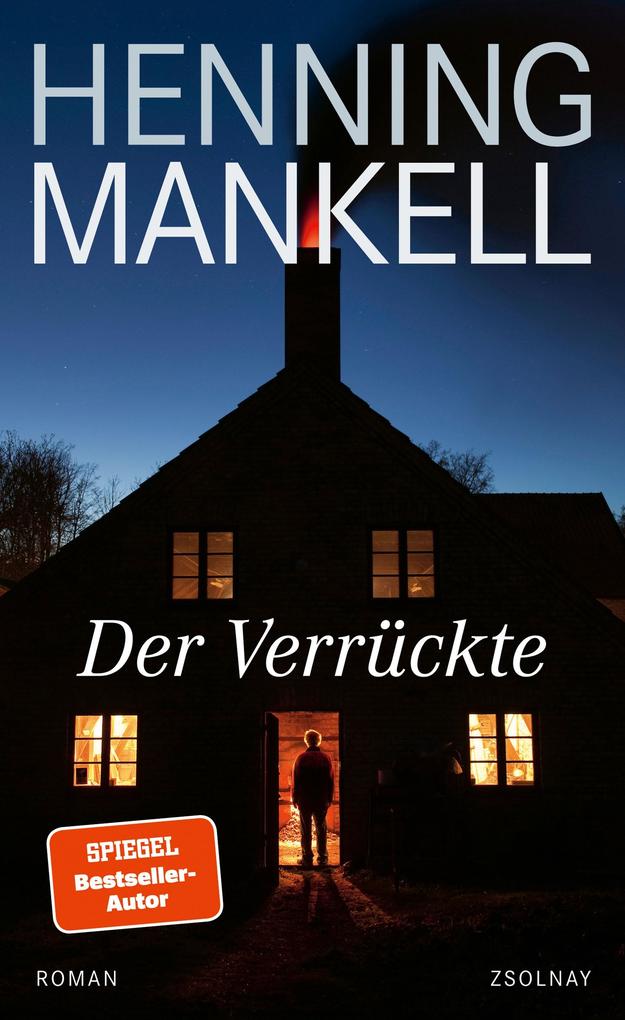Ein fremder junger Mann, Bertil Kras, taucht in einer kleinen, eingeschworenen schwedischen Marktgemeinde auf. Sein (soziales) Ende, nämlich jenes eines langen Prozesses der Ausgrenzung, wird zu Beginn des Romans erzählt.
Als Kras die Marktgemeinde betritt, sucht er nach einem Kirchturm mit Ziffernblatt - vergeblich: Hier scheint die Zeit stillzustehen. Es ist das Jahr 1947, das Kriegsgefangenenlager der internierten Kommunisten, die zuvor Nachbarn waren, gilt längst als vergessen. Besser: Darüber spricht man nicht. Doch der junge Fremde, der in dem in der Gemeinde ansässigen Sägewerk Arbeit findet, äußert sich gleich zu Beginn folgendermaßen: Familienunternehmen sind nichts gutes Es ist falsch, dass eine einzige Familie über so viel Geld und so viele Leute bestimmen kann... Mit dieser anfänglichen Äußerung besiegelt Kras direkt sein Schicksal: Er wird zum Außenseiter und zum Sündenbock für den sich später ereignenden Brand im Sägewerk erklärt. Rettung? Auswegslos. Kras ist bereits gebrandmarkt.
Dieser Gesellschaftsroman des brillanten - damals End-Zwanziger - schwedischen Schriftsteller Hennig Mankell lässt bereits tief in dessen politische Gesinnung und seiner Kritik der politischen Missstände blicken. Nun - 42 Jahre nach Erstveröffentlichung in Schweden, ist der Roman auf Deutsch verlegt worden und zeigt die Schatten des schwedischen Wohlfahrtsstaates auf. Die Kollaborationen des schwedischen gut bürgerlichen Milieus dieses (nicht namentlich benannten) Marktfleckens wurden unter den Tisch gekehrt. Der junge Fremde wird als Gefahr eingestuft, als Unruhestifter, der die Nachkriegsidylle stören könnte. Damit ist sein sozialer Tod schnell besiegelt.
Mankell erzählt in seinem sich über 500 Seiten erstreckenden Roman die Chronik des sozialen Mordes an Bertil Kras. Es ist ein stiller Roman, in dem nicht viel passiert, sondern vor allem zwischen den Zeilen die Gesellschaftskritik herausgelesen werden muss. Kras, aber auch die weiteren Protagonisten, eint eine Melancholie, die doch sehr typisch für viele von Mankells spätere Romanfiguren ist. In diesem Roman scheint es, als wenn die überall und zu jeder Zeit getrunkene Tasse Kaffee das Allheilmittel für diese Schwermütigkeit ist ...
Akribisch erzählt Mankell von der sozialen Hetzjagd auf Kras, die sich über Jahre hinzieht, während sich Kras ein Leben in der Marktgemeinde aufbaut. Ein Leben, in dem er, wie es scheint, nie ankommen kann. Dabei verliert sich Mankell in seinem Mammutwerk in vielen Details, die aufgrund seines sprachlichen Könnens nicht stören, dem Roman aber die Spannung nehmen. Auch schafft es Mankell nicht vollständig, dass man sich als LeserIn der Figur Kras nähern kann, so wie er es bspw. in Der Chronist der Winde schafft, wo man mit Nelio mitfiebert
Der Verrückte ist eine subtile Kritik am schwedischen Wohlfahrtsstaat und einer Politik der Verdrängung erzählt am Beispiel des jungen Kommunisten Bertil Kras. Der Roman regt zum Nachdenken an, konnte mich aber nicht packen, da er sehr langwierig und zu ausführlich ist.
Meine Empfehlung für diesen Roman geht dennoch an alle Mankell-Fans (denn leider werden von diesem wunderbaren Autoren ja keine weiteren folgen), Liebhabern von Gesellschaftsromanen sowie politisch und geschichtlich interessierten Menschen mit Freude am Detail.