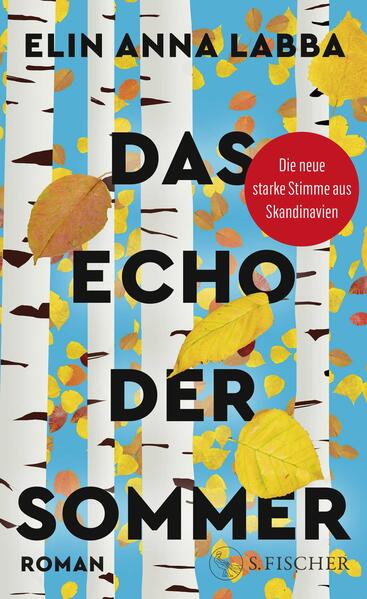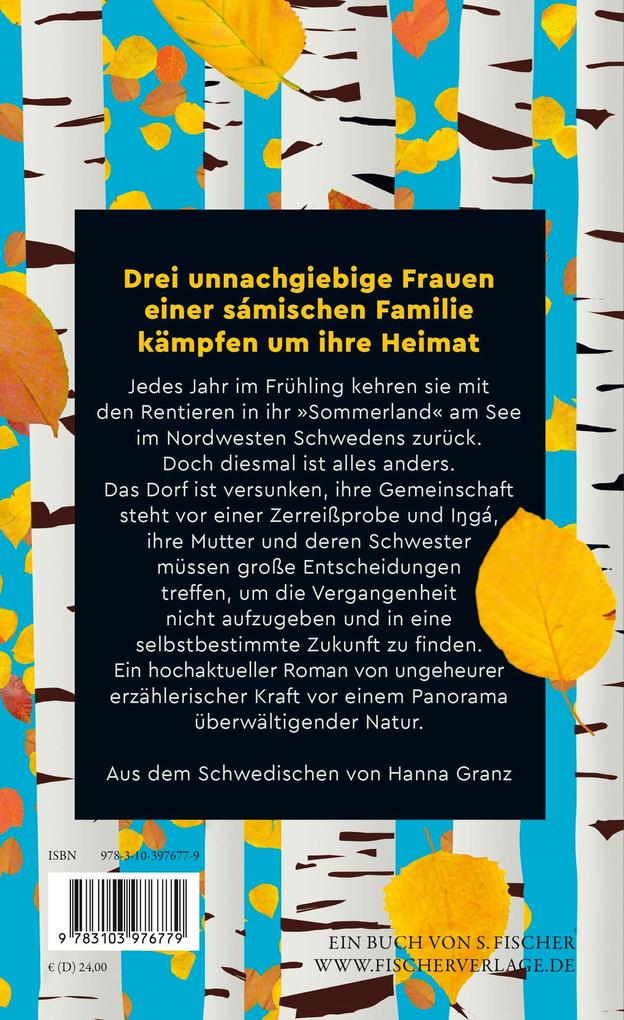Am Anfang des Buches lernen wir die 3 Hauptprotagonistinnen kennen, eine samische Familie, die Aufgrund des Baus eines Staudamms, immer wieder vertrieben und gezwungen wird, sich eine neue Bleibe aufzubauen. Ebenso lernen wir sehr eindrücklich das Leben des samischen Volkes kennen, unter anderem auch deren Sprache, die öfters verwendet wurde. Der Schreibstil ist sehr kraftvoll, die Landschaften, das Leben des samischen Volkes sowie ihre Traditionen werden sehr detailreich erzählt, für mich persönlich hätten einige Stellen auch kürzer sein können. Im Lesefluss hat mich ein wenig gestört, dass hier die Sprache des samischen Volkes verwendet wurde, grundsätzlich eine gute Idee, jedoch teilweise ohne jegliche Übersetzung, somit war das etwas zäh für mich. Ein kleines Glossar wäre sehr hilfreich gewesen.
Dennoch finde ich, dass die Charaktere unglaublich echt wirken: lebendig, greifbar und überzeugend. Die ganzen Emotionen, wie das Leid, die Trauer und Freude, waren absolut spürbar. Irgendwie hat das Buch etwas Melancholisches an sich, was ich hier nicht negativ meine. Es nimmt einen mit, wenn man bedenkt, was dieses Volk schon alles durchgemacht hat.
Ein wichtiges Thema das hier aufgegriffen wurde und hierzulande vielleicht gar nicht so bekannt ist. Es ist definitiv lesenswert, auch wenn es meinen Geschmack nicht ganz getroffen hat.