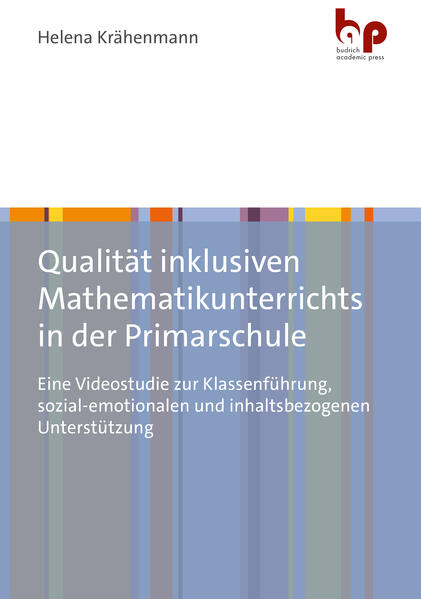
Zustellung: Di, 17.06. - Do, 19.06.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiInfolge von Inklusionsbestrebungen im Bildungssystem werden vermehrt Schüler*innen mit erhöhtem Förderbedarf in Regelschulen unterrichtet, woraus ein Forschungsdesiderat hervorgeht. Das vorliegende Buch knüpft hier mit einer Videostudie zur Gestaltung und Qualität inklusiven Mathematikunterrichts auf der Primarstufe hinsichtlich Klassenführung, sozial-emotionaler und inhaltsbezogener Unterstützung an. Die Ergebnisse zeigen unter anderem die Relevanz der räumlichen Organisation und der Klassenlehrpersonen für die sozial-emotionale Unterstützung.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Ziele der Arbeit
Aufbau der Arbeit
1. Inklusiver Unterricht
1. 1 Der Begriff inklusiver Unterricht
1. 2 Begriffsklärung intellektuelle Beeinträchtigung
1. 3 Beschulung von Kindern mit intellektueller Beeinträchtigung in der Schweiz
1. 4 Zusammenfassung in Bezug auf die vorliegende Arbeit
2. Unterrichtsqualität
2. 1 Einblicke in die Entwicklung der empirischen Unterrichtsforschung zur Unterrichtsqualität
2. 1. 1 Forschungstrend Unterrichtsqualität
2. 1. 2 Vom Prozess-Produkt-Modell zum Prozess-Mediations-Produkt-Modell
2. 2 Merkmale von Unterrichtsqualität
2. 2. 1 Merkmalskataloge
2. 2. 2 Basisdimensionen
2. 3 Videographie
2. 4 Ausgewählte Forschungsergebnisse zur Unterrichtsqualität auf der Primarschulstufe
2. 5 Zusammenfassung in Bezug auf die vorliegende Arbeit
3. Unterricht und Didaktik im inklusiven Kontext Fokus Qualität
3. 1 Merkmale eines inklusiven Unterrichts
3. 1. 1 Soziale Partizipation und Herstellung einer Lerngemeinschaft
3. 1. 2 Entwicklungsorientierter Unterricht und innere Differenzierung
3. 1. 3 Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit von Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagog*innen
3. 2 Konzepte und Ansätze einer inklusiven Didaktik
3. 2. 1 Lernen am gemeinsamen Gegenstand
3. 2. 2 Inklusionsdidaktische Netzwerke
3. 2. 3 Response-to-Intervention Modell
3. 2. 4 Universal Design of Learning
3. 2. 5 MehrPerspektivenSchema
3. 2. 6 Einschätzung der Konzepte einer inklusiven Didaktik
3. 3 Ausgewählte Studien zu qualitativen Aspekten im inklusiven Primarschulunterricht
3. 4 Instrumente zur Einschätzung von Qualität im inklusiven Unterricht
3. 5 Zusammenfassung in Bezug auf die vorliegende Arbeit
4. Klassenführung
4. 1 Begriffsklärung von Klassenführung
4. 2 Forschungsbefunde zur Klassenführung auf der Grundschulstufe (in inklusiven Settings)
4. 2. 1 Befunde der Unterrichtsqualitätsforschung zur Klassenführung auf der Grundschulstufe
4. 2. 2 Forschungsbefunde zur Klassenführung in inklusiven Schulsettings und Gegenüberstellung zu Ergebnissen aus der Unterrichtsqualitätsforschung
4. 3 Zentrale Aspekte einer effizienten Klassenführung im inklusiven Unterricht
4. 3. 1 Zusammenarbeit von Klassenlehrpersonen und Fachpersonen der Schulischen Heilpädagogik im Hinblick auf eine gemeinsame Klassenführung
4. 3. 1. 1 Modelle zur Zusammenarbeit zwischen Fachpersonen aus Regel- und Sonderpädagogik
4. 3. 1. 2 Erkenntnisse aus der Forschung zur unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit
4. 3. 1. 3 Gemeinsame Klassenführung
4. 3. 2 Effizientes Zeitmanagement
4. 3. 3 Regelklarheit
4. 4 Klassenführung Zusammenfassung und Ausblick auf das Instrument
5. Unterstützung von Schüler*innen
5. 1 Begriffsklärung
5. 2 Sozial-emotionale Unterstützung
5. 2. 1 Sozial-emotionale Unterstützung oder Unterrichtsklima eine Begriffsklärung
5. 2. 2 Bedeutung sozial-emotionaler Unterstützung im (inklusiven) Unterricht
5. 2. 2. 1 Auswirkungen sozial-emotionaler Unterstützung im Grundschulunterricht
5. 2. 2. 2 Bedeutung sozial-emotionaler Unterstützung im inklusiven Unterricht
5. 2. 2. 3 Zusammenfassung
5. 2. 3 Sozial-emotional unterstützende Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden
5. 2. 3. 1 Sozial-emotional unterstützenden Interaktion zwischen Lehrpersonen und Lernenden basierend auf der Unterrichtqualitätsforschung
5. 2. 3. 2 Sozial-emotionale Interaktion zwischen Lehrpersonen und Lernenden mit sonderpädagogischem Förderbedarf basierend auf der Forschung in inklusiven Schulsettings
5. 2. 3. 3 Zusammenfassung
5. 2. 4 Soziale Interaktion zwischen Lernenden mit und ohne Beeinträchtigungen
5. 2. 4. 1 Soziale Interaktion als Teilkomponente sozialer Partizipation
5. 2. 4. 2 Sozial-interaktive Unterrichtsaktivitäten in inklusiven Settings
5. 2. 4. 3 Tragweite und Merkmale sozial positiver Interaktionen zwischen Lernenden Einblick in die Perspektive der Unterrichtsforschung
5. 2. 4. 4 Zusammenfassung
5. 2. 5 Sozialer Interaktionsraum
5. 2. 5. 1 Die Relativistische Raumtheorie und ihre Übertragung auf den (inklusiven) Unterricht
5. 2. 5. 2 Raumforschung innerhalb der Erziehungswissenschaft
5. 2. 5. 3 Die Bedeutung von Raum im Kontext von Schule und Inklusion
5. 2. 5. 4 Öffnung und Schließung sozialer Interaktionsräume in inklusiven Settings
5. 2. 5. 5 Zusammenfassung
5. 2. 6 Umgang mit Fehlern
5. 2. 6. 1 Fehler als Chance oder als Makel?
5. 2. 6. 2 Positive Fehlerkultur
5. 2. 6. 3 Erkenntnisse aus Studien zum Umgang mit Fehlern
5. 2. 6. 4 Zusammenfassung
5. 2. 7 Sozial-emotionale Unterstützung Zusammenfassung und Ausblick auf das Instrument
5. 3 Inhaltsbezogene Unterstützung unter Berücksichtigung des Faches Mathematik
5. 3. 1 Inhaltsbezogene Interaktionen
5. 3. 2 Gemeinsame Lernsituationen
5. 3. 2. 1 Begriffsklärung gemeinsame Lernsituationen
5. 3. 2. 2 Bedeutung sozialer Prozesse für das (Mathematik-)Lernen
5. 3. 2. 3 Effekte gemeinsamer Lernsituationen auf die Schulleistung
5. 3. 2. 4 Gemeinsame Lernsituationen im inklusiven Mathematikunterricht
5. 3. 2. 5 Zusammenfassung
5. 3. 3 Innere Differenzierung
5. 3. 3. 1 Begriffsklärung Differenzierung
5. 3. 3. 2 Innere versus äußere Differenzierung im inklusiven Unterricht
5. 3. 3. 3 Bedeutsamkeit innerer Differenzierung
5. 3. 3. 4 Konzept Innere Differenzierung nach Klafki und Stöcker
5. 3. 3. 5 Formen der inneren Differenzierung im Unterricht
5. 3. 3. 6 Differenzierung im inklusiven Mathematikunterricht
5. 3. 3. 7 Studien zur Differenzierung im inklusiven (Mathematik-)Unterricht
5. 3. 3. 8 Zusammenfassung
5. 3. 4 Unterstützung beim Mathematiklernen durch Arbeitsmittel und Veranschaulichungen
5. 3. 4. 1 Mathematischer Entwicklungsprozess bei Kindern mit intellektueller Beeinträchtigung die Bedeutung mathematischer Basiskompetenzen
5. 3. 4. 2 Arbeitsmittel und Veranschaulichungen im Mathematikunterricht
5. 3. 4. 3 Empirische Befunde zum Einsatz von Arbeitsmitteln und Veranschaulichungen bei Kindern mit (intellektueller) Beeinträchtigung
5. 3. 4. 4 Zentrale Aspekte beim Einsatz von Arbeitsmitteln und Veranschaulichungen
5. 3. 4. 5 Gütekriterien für Arbeitsmittel und Veranschaulichungen
5. 3. 4. 6 Zusammenfassung
5. 3. 5 Inhaltsbezogene Unterstützung Zusammenfassung und Ausblick auf das Instrument
6. Unterrichtsgestaltung und -qualität mit Fokus auf Klassenführung und Unterstützung im inklusiven Mathematikunterricht ein Modell
7. Fragestellungen
7. 1 Forschungsfragen zur Repräsentativität der Videodaten und Reliabilität der videobasierten Codierungen und Ratings
7. 1. 1 Forschungsfrage zur Repräsentativität der Videodaten
7. 1. 2 Forschungsfragen zur Reliabilität der videobasierten Codierungen und Ratings
7. 2 Forschungsfragen zur Unterrichtsgestaltung und -qualität im inklusiven Mathematikunterricht
7. 2. 1 Forschungsfragen zur Klassenführung
7. 2. 2 Forschungsfragen zur Unterstützung der Schüler*innen
7. 2. 2. 1 Fragen zur sozial-emotionalen Unterstützung der Schüler*innen
7. 2. 2. 2 Fragen zur inhaltsbezogenen Unterstützung der Schüler*innen im Mathematikunterricht
7. 3 Forschungsfragen zum Konstrukt des Ratinginstruments
7. 4 Forschungsfragen zu Gruppierungen der Daten
7. 4. 1 Forschungsfrage zum Clustering der Ratingdaten
7. 4. 2 Forschungsfragen zur Typenbildung auf Basis der Interview-, Codier- und Ratingdaten
8. Methodisches Vorgehen
8. 1 Videobasierte Analyse von Unterrichtsprozessen
8. 1. 1 Vorteile und Herausforderungen videobasierter Unterrichtsforschung
8. 1. 2 Niedrig und mittel inferente Codierverfahren
8. 1. 3 Hoch inferente Ratingverfahren
8. 1. 4 Gütekriterien zur Objektivitäts- und Validitätssicherung
8. 1. 5 Ratereffekte bei hoch inferenten Ratingverfahren
8. 1. 6 Generalisierbarkeitstheorie zur Reliabilitätsüberprüfung hoch inferenter Ratings
8. 1. 7 Ausblick auf das Vorgehen in der vorliegenden Arbeit
8. 2 Datenerhebung und -aufbereitung im Rahmen der Videostudie
8. 2. 1 Untersuchungskontext: Forschungsprojekt SirIus
8. 2. 2 Stichprobe der Videostudie
8. 2. 3 Ablauf der Videostudie
8. 2. 4 Erhebung und Aufbereitung der Video- und Interviewdaten
8. 3 Auswertung der Daten
8. 3. 1 Qualitative Inhaltsanalyse zur Auswertung der Interviews
8. 3. 1. 1 Repräsentativität des Videomaterials
8. 3. 1. 2 Begründungen zur Organisation der Lernorte
8. 3. 2 Übersicht über die Beobachtungsinstrumente
8. 3. 3 Niedrig und mittel inferente Codierung der Videodaten
8. 3. 3. 1 Entwicklung und Erprobung des Instruments zur Basiscodierung
8. 3. 3. 2 Entwicklung und Erprobung des Instrumentes zur niedrig inferenten Codierung
8. 3. 3. 3 Entwicklung und Erprobung des Instruments zur mittel inferenten Codierung
8. 3. 4 Hoch inferentes Rating der Videodaten
8. 3. 4. 1 Entwicklung des Ratinginstruments
8. 3. 4. 2 Ablauf des Ratingverfahrens
8. 3. 5 Auswertungsverfahren auf Basis der Inhaltsanalyse-, Codier- und Ratingdaten
8. 3. 5. 1 Deskriptive Statistik
8. 3. 5. 2 Analysen zu Zusammenhängen und Unterschieden
8. 3. 5. 3 Reliabilitätsanalyse zur Prüfung der internen Konsistenz
8. 3. 5. 4 Explorative Faktorenanalyse
8. 3. 5. 5 Clusteranalyse
8. 3. 5. 6 Typenbildung
9. Ergebnisse
9. 1 Repräsentativität der Videodaten und Reliabilität der Messinstrumente
9. 1. 1 Repräsentativität des Videomaterials
9. 1. 2 Intercoderreliabilität
9. 1. 3 Interraterreliabilität
9. 1. 4 Zusammenfassung
9. 2 Unterrichtsgestaltung und -qualität mit Fokus auf die Klassenführung und Unterstützung von Schüler*innen im inklusiven Mathematikunterricht
9. 2. 1 Lektionsdauer
9. 2. 2 Übersicht zur qualitativen Ausprägung der hoch inferent eingeschätzten Unterrichtsmerkmale
9. 2. 3 Klassenführung
9. 2. 3. 1 Qualitative Ausprägung der Klassenführung
9. 2. 3. 2 Unterschiede zwischen den Professionsgruppen hinsichtlich der Klassenführung
9. 2. 4 Sozial-emotionale Unterstützung der Schüler*innen
9. 2. 4. 1 Ausmaß an interaktiver Begleitung von Kindern mit IB
9. 2. 4. 2 Gestaltung des sozialen Interaktionsraums und der Sozialformen
9. 2. 4. 3 Qualitative Ausprägung der sozial-emotionalen Unterstützung
9. 2. 4. 4 Vergleich zwischen den Akteursgruppen hinsichtlich der sozial-emotionalen Unterstützung von Lernenden mit IB
9. 2. 4. 5 Zusammenhangsanalysen
9. 2. 4. 6 Zusammenfassung
9. 2. 5 Inhaltsbezogene Unterstützung der Schüler*innen
9. 2. 5. 1 Ausmaß mathematischer Aktivitäten und Interaktionen
9. 2. 5. 2 Qualitative Ausprägung der inhaltsbezogenen Unterstützung
9. 2. 5. 3 Zusammenhangsanalysen
9. 2. 5. 4 Zusammenfassung
9. 3 Überprüfung des Ratinginstruments
9. 3. 1 Reliabilitätsanalyse zur Prüfung der internen Konsistenz
9. 3. 2 Explorative Faktorenanalyse
9. 3. 2. 1 Dateneignung für eine explorative Faktorenanalyse
9. 3. 2. 2 Hauptkomponentenanalyse
9. 3. 2. 3 Faktorenlösung
9. 3. 2. 4 Reliabilitätsanalyse der dreifaktoriellen Lösung
9. 3. 2. 5 Summenwerte
9. 3. 3 Zusammenfassung
9. 4 Analysen zur Gruppierung der Daten
9. 4. 1 Clusteranalyse zur Unterrichtsqualität
9. 4. 1. 1 Clusterlösungen
9. 4. 1. 2 Clusterlösungen in Verbindung mit Kontextvariablen
9. 4. 1. 3 Zusammenfassung
9. 4. 2 Typenbildung mit Fokus auf Interaktions- und Lernräume
9. 4. 2. 1 Typenbildung
9. 4. 2. 2 Typenbildung in Bezug zu Kontextvariablen
9. 4. 2. 3 Zusammenfassung
10. Zusammenfassung und Diskussion
10. 1 Die Gestaltung und Qualität inklusiven Mathematikunterrichts auf der Primarstufe
10. 1. 1 Klassenführung
10. 1. 2 Sozial-emotionale Unterstützung von Schüler*innen mit intellektueller Beeinträchtigung
10. 1. 3 Inhaltsbezogene Unterstützung der Schüler*innen
10. 1. 4 Merkmalsbasierte Cluster und Typen im inklusiven Mathematikunterricht
10. 1. 5 Nested instruction in inklusiven Settings mit multiprofessionellen Klassenteams
10. 1. 6 Implikationen für die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagog*innen
10. 2 Diskussion des methodischen Vorgehens
10. 2. 1 Datenerhebung
10. 2. 2 Einschätzung der entwickelten Instrumente für die Videodatenauswertung
10. 2. 3 Grenzen der Studie
10. 3 Ansätze und Fragen für die weitere Forschung
11. Literaturverzeichnis
12. Tabellenverzeichnis
13. Abbildungsverzeichnis
14. Anhang
14. 1 Basiscodierung: Auszug aus dem Kategoriensystem zur Lektionsdauer und den Sozialformen
14. 2 Niedrig inferentes Kategoriensystem Auszüge
14. 2. 1 Organisation des sozialen Interaktionsraums für Kinder mit und ohne intellektuelle Beeinträchtigung
14. 2. 2 Ausmaß an interaktiver Begleitung von Kindern mit intellektueller Beeinträchtigung
14. 2. 3 Sozialformen des gelenkten Unterrichts mit Fokus auf Kinder mit intellektueller Beeinträchtigung
14. 2. 4 Inhaltliche Aktivitäten
14. 2. 5 Auszug aus den allgemeinen Codierhinweisen für alle niedrig inferenten Codierungen
14. 3 Mittel inferentes Kategoriensystem Auszüge
14. 4 Hoch inferentes Ratingsystem Auszüge
Ziele der Arbeit
Aufbau der Arbeit
1. Inklusiver Unterricht
1. 1 Der Begriff inklusiver Unterricht
1. 2 Begriffsklärung intellektuelle Beeinträchtigung
1. 3 Beschulung von Kindern mit intellektueller Beeinträchtigung in der Schweiz
1. 4 Zusammenfassung in Bezug auf die vorliegende Arbeit
2. Unterrichtsqualität
2. 1 Einblicke in die Entwicklung der empirischen Unterrichtsforschung zur Unterrichtsqualität
2. 1. 1 Forschungstrend Unterrichtsqualität
2. 1. 2 Vom Prozess-Produkt-Modell zum Prozess-Mediations-Produkt-Modell
2. 2 Merkmale von Unterrichtsqualität
2. 2. 1 Merkmalskataloge
2. 2. 2 Basisdimensionen
2. 3 Videographie
2. 4 Ausgewählte Forschungsergebnisse zur Unterrichtsqualität auf der Primarschulstufe
2. 5 Zusammenfassung in Bezug auf die vorliegende Arbeit
3. Unterricht und Didaktik im inklusiven Kontext Fokus Qualität
3. 1 Merkmale eines inklusiven Unterrichts
3. 1. 1 Soziale Partizipation und Herstellung einer Lerngemeinschaft
3. 1. 2 Entwicklungsorientierter Unterricht und innere Differenzierung
3. 1. 3 Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit von Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagog*innen
3. 2 Konzepte und Ansätze einer inklusiven Didaktik
3. 2. 1 Lernen am gemeinsamen Gegenstand
3. 2. 2 Inklusionsdidaktische Netzwerke
3. 2. 3 Response-to-Intervention Modell
3. 2. 4 Universal Design of Learning
3. 2. 5 MehrPerspektivenSchema
3. 2. 6 Einschätzung der Konzepte einer inklusiven Didaktik
3. 3 Ausgewählte Studien zu qualitativen Aspekten im inklusiven Primarschulunterricht
3. 4 Instrumente zur Einschätzung von Qualität im inklusiven Unterricht
3. 5 Zusammenfassung in Bezug auf die vorliegende Arbeit
4. Klassenführung
4. 1 Begriffsklärung von Klassenführung
4. 2 Forschungsbefunde zur Klassenführung auf der Grundschulstufe (in inklusiven Settings)
4. 2. 1 Befunde der Unterrichtsqualitätsforschung zur Klassenführung auf der Grundschulstufe
4. 2. 2 Forschungsbefunde zur Klassenführung in inklusiven Schulsettings und Gegenüberstellung zu Ergebnissen aus der Unterrichtsqualitätsforschung
4. 3 Zentrale Aspekte einer effizienten Klassenführung im inklusiven Unterricht
4. 3. 1 Zusammenarbeit von Klassenlehrpersonen und Fachpersonen der Schulischen Heilpädagogik im Hinblick auf eine gemeinsame Klassenführung
4. 3. 1. 1 Modelle zur Zusammenarbeit zwischen Fachpersonen aus Regel- und Sonderpädagogik
4. 3. 1. 2 Erkenntnisse aus der Forschung zur unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit
4. 3. 1. 3 Gemeinsame Klassenführung
4. 3. 2 Effizientes Zeitmanagement
4. 3. 3 Regelklarheit
4. 4 Klassenführung Zusammenfassung und Ausblick auf das Instrument
5. Unterstützung von Schüler*innen
5. 1 Begriffsklärung
5. 2 Sozial-emotionale Unterstützung
5. 2. 1 Sozial-emotionale Unterstützung oder Unterrichtsklima eine Begriffsklärung
5. 2. 2 Bedeutung sozial-emotionaler Unterstützung im (inklusiven) Unterricht
5. 2. 2. 1 Auswirkungen sozial-emotionaler Unterstützung im Grundschulunterricht
5. 2. 2. 2 Bedeutung sozial-emotionaler Unterstützung im inklusiven Unterricht
5. 2. 2. 3 Zusammenfassung
5. 2. 3 Sozial-emotional unterstützende Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden
5. 2. 3. 1 Sozial-emotional unterstützenden Interaktion zwischen Lehrpersonen und Lernenden basierend auf der Unterrichtqualitätsforschung
5. 2. 3. 2 Sozial-emotionale Interaktion zwischen Lehrpersonen und Lernenden mit sonderpädagogischem Förderbedarf basierend auf der Forschung in inklusiven Schulsettings
5. 2. 3. 3 Zusammenfassung
5. 2. 4 Soziale Interaktion zwischen Lernenden mit und ohne Beeinträchtigungen
5. 2. 4. 1 Soziale Interaktion als Teilkomponente sozialer Partizipation
5. 2. 4. 2 Sozial-interaktive Unterrichtsaktivitäten in inklusiven Settings
5. 2. 4. 3 Tragweite und Merkmale sozial positiver Interaktionen zwischen Lernenden Einblick in die Perspektive der Unterrichtsforschung
5. 2. 4. 4 Zusammenfassung
5. 2. 5 Sozialer Interaktionsraum
5. 2. 5. 1 Die Relativistische Raumtheorie und ihre Übertragung auf den (inklusiven) Unterricht
5. 2. 5. 2 Raumforschung innerhalb der Erziehungswissenschaft
5. 2. 5. 3 Die Bedeutung von Raum im Kontext von Schule und Inklusion
5. 2. 5. 4 Öffnung und Schließung sozialer Interaktionsräume in inklusiven Settings
5. 2. 5. 5 Zusammenfassung
5. 2. 6 Umgang mit Fehlern
5. 2. 6. 1 Fehler als Chance oder als Makel?
5. 2. 6. 2 Positive Fehlerkultur
5. 2. 6. 3 Erkenntnisse aus Studien zum Umgang mit Fehlern
5. 2. 6. 4 Zusammenfassung
5. 2. 7 Sozial-emotionale Unterstützung Zusammenfassung und Ausblick auf das Instrument
5. 3 Inhaltsbezogene Unterstützung unter Berücksichtigung des Faches Mathematik
5. 3. 1 Inhaltsbezogene Interaktionen
5. 3. 2 Gemeinsame Lernsituationen
5. 3. 2. 1 Begriffsklärung gemeinsame Lernsituationen
5. 3. 2. 2 Bedeutung sozialer Prozesse für das (Mathematik-)Lernen
5. 3. 2. 3 Effekte gemeinsamer Lernsituationen auf die Schulleistung
5. 3. 2. 4 Gemeinsame Lernsituationen im inklusiven Mathematikunterricht
5. 3. 2. 5 Zusammenfassung
5. 3. 3 Innere Differenzierung
5. 3. 3. 1 Begriffsklärung Differenzierung
5. 3. 3. 2 Innere versus äußere Differenzierung im inklusiven Unterricht
5. 3. 3. 3 Bedeutsamkeit innerer Differenzierung
5. 3. 3. 4 Konzept Innere Differenzierung nach Klafki und Stöcker
5. 3. 3. 5 Formen der inneren Differenzierung im Unterricht
5. 3. 3. 6 Differenzierung im inklusiven Mathematikunterricht
5. 3. 3. 7 Studien zur Differenzierung im inklusiven (Mathematik-)Unterricht
5. 3. 3. 8 Zusammenfassung
5. 3. 4 Unterstützung beim Mathematiklernen durch Arbeitsmittel und Veranschaulichungen
5. 3. 4. 1 Mathematischer Entwicklungsprozess bei Kindern mit intellektueller Beeinträchtigung die Bedeutung mathematischer Basiskompetenzen
5. 3. 4. 2 Arbeitsmittel und Veranschaulichungen im Mathematikunterricht
5. 3. 4. 3 Empirische Befunde zum Einsatz von Arbeitsmitteln und Veranschaulichungen bei Kindern mit (intellektueller) Beeinträchtigung
5. 3. 4. 4 Zentrale Aspekte beim Einsatz von Arbeitsmitteln und Veranschaulichungen
5. 3. 4. 5 Gütekriterien für Arbeitsmittel und Veranschaulichungen
5. 3. 4. 6 Zusammenfassung
5. 3. 5 Inhaltsbezogene Unterstützung Zusammenfassung und Ausblick auf das Instrument
6. Unterrichtsgestaltung und -qualität mit Fokus auf Klassenführung und Unterstützung im inklusiven Mathematikunterricht ein Modell
7. Fragestellungen
7. 1 Forschungsfragen zur Repräsentativität der Videodaten und Reliabilität der videobasierten Codierungen und Ratings
7. 1. 1 Forschungsfrage zur Repräsentativität der Videodaten
7. 1. 2 Forschungsfragen zur Reliabilität der videobasierten Codierungen und Ratings
7. 2 Forschungsfragen zur Unterrichtsgestaltung und -qualität im inklusiven Mathematikunterricht
7. 2. 1 Forschungsfragen zur Klassenführung
7. 2. 2 Forschungsfragen zur Unterstützung der Schüler*innen
7. 2. 2. 1 Fragen zur sozial-emotionalen Unterstützung der Schüler*innen
7. 2. 2. 2 Fragen zur inhaltsbezogenen Unterstützung der Schüler*innen im Mathematikunterricht
7. 3 Forschungsfragen zum Konstrukt des Ratinginstruments
7. 4 Forschungsfragen zu Gruppierungen der Daten
7. 4. 1 Forschungsfrage zum Clustering der Ratingdaten
7. 4. 2 Forschungsfragen zur Typenbildung auf Basis der Interview-, Codier- und Ratingdaten
8. Methodisches Vorgehen
8. 1 Videobasierte Analyse von Unterrichtsprozessen
8. 1. 1 Vorteile und Herausforderungen videobasierter Unterrichtsforschung
8. 1. 2 Niedrig und mittel inferente Codierverfahren
8. 1. 3 Hoch inferente Ratingverfahren
8. 1. 4 Gütekriterien zur Objektivitäts- und Validitätssicherung
8. 1. 5 Ratereffekte bei hoch inferenten Ratingverfahren
8. 1. 6 Generalisierbarkeitstheorie zur Reliabilitätsüberprüfung hoch inferenter Ratings
8. 1. 7 Ausblick auf das Vorgehen in der vorliegenden Arbeit
8. 2 Datenerhebung und -aufbereitung im Rahmen der Videostudie
8. 2. 1 Untersuchungskontext: Forschungsprojekt SirIus
8. 2. 2 Stichprobe der Videostudie
8. 2. 3 Ablauf der Videostudie
8. 2. 4 Erhebung und Aufbereitung der Video- und Interviewdaten
8. 3 Auswertung der Daten
8. 3. 1 Qualitative Inhaltsanalyse zur Auswertung der Interviews
8. 3. 1. 1 Repräsentativität des Videomaterials
8. 3. 1. 2 Begründungen zur Organisation der Lernorte
8. 3. 2 Übersicht über die Beobachtungsinstrumente
8. 3. 3 Niedrig und mittel inferente Codierung der Videodaten
8. 3. 3. 1 Entwicklung und Erprobung des Instruments zur Basiscodierung
8. 3. 3. 2 Entwicklung und Erprobung des Instrumentes zur niedrig inferenten Codierung
8. 3. 3. 3 Entwicklung und Erprobung des Instruments zur mittel inferenten Codierung
8. 3. 4 Hoch inferentes Rating der Videodaten
8. 3. 4. 1 Entwicklung des Ratinginstruments
8. 3. 4. 2 Ablauf des Ratingverfahrens
8. 3. 5 Auswertungsverfahren auf Basis der Inhaltsanalyse-, Codier- und Ratingdaten
8. 3. 5. 1 Deskriptive Statistik
8. 3. 5. 2 Analysen zu Zusammenhängen und Unterschieden
8. 3. 5. 3 Reliabilitätsanalyse zur Prüfung der internen Konsistenz
8. 3. 5. 4 Explorative Faktorenanalyse
8. 3. 5. 5 Clusteranalyse
8. 3. 5. 6 Typenbildung
9. Ergebnisse
9. 1 Repräsentativität der Videodaten und Reliabilität der Messinstrumente
9. 1. 1 Repräsentativität des Videomaterials
9. 1. 2 Intercoderreliabilität
9. 1. 3 Interraterreliabilität
9. 1. 4 Zusammenfassung
9. 2 Unterrichtsgestaltung und -qualität mit Fokus auf die Klassenführung und Unterstützung von Schüler*innen im inklusiven Mathematikunterricht
9. 2. 1 Lektionsdauer
9. 2. 2 Übersicht zur qualitativen Ausprägung der hoch inferent eingeschätzten Unterrichtsmerkmale
9. 2. 3 Klassenführung
9. 2. 3. 1 Qualitative Ausprägung der Klassenführung
9. 2. 3. 2 Unterschiede zwischen den Professionsgruppen hinsichtlich der Klassenführung
9. 2. 4 Sozial-emotionale Unterstützung der Schüler*innen
9. 2. 4. 1 Ausmaß an interaktiver Begleitung von Kindern mit IB
9. 2. 4. 2 Gestaltung des sozialen Interaktionsraums und der Sozialformen
9. 2. 4. 3 Qualitative Ausprägung der sozial-emotionalen Unterstützung
9. 2. 4. 4 Vergleich zwischen den Akteursgruppen hinsichtlich der sozial-emotionalen Unterstützung von Lernenden mit IB
9. 2. 4. 5 Zusammenhangsanalysen
9. 2. 4. 6 Zusammenfassung
9. 2. 5 Inhaltsbezogene Unterstützung der Schüler*innen
9. 2. 5. 1 Ausmaß mathematischer Aktivitäten und Interaktionen
9. 2. 5. 2 Qualitative Ausprägung der inhaltsbezogenen Unterstützung
9. 2. 5. 3 Zusammenhangsanalysen
9. 2. 5. 4 Zusammenfassung
9. 3 Überprüfung des Ratinginstruments
9. 3. 1 Reliabilitätsanalyse zur Prüfung der internen Konsistenz
9. 3. 2 Explorative Faktorenanalyse
9. 3. 2. 1 Dateneignung für eine explorative Faktorenanalyse
9. 3. 2. 2 Hauptkomponentenanalyse
9. 3. 2. 3 Faktorenlösung
9. 3. 2. 4 Reliabilitätsanalyse der dreifaktoriellen Lösung
9. 3. 2. 5 Summenwerte
9. 3. 3 Zusammenfassung
9. 4 Analysen zur Gruppierung der Daten
9. 4. 1 Clusteranalyse zur Unterrichtsqualität
9. 4. 1. 1 Clusterlösungen
9. 4. 1. 2 Clusterlösungen in Verbindung mit Kontextvariablen
9. 4. 1. 3 Zusammenfassung
9. 4. 2 Typenbildung mit Fokus auf Interaktions- und Lernräume
9. 4. 2. 1 Typenbildung
9. 4. 2. 2 Typenbildung in Bezug zu Kontextvariablen
9. 4. 2. 3 Zusammenfassung
10. Zusammenfassung und Diskussion
10. 1 Die Gestaltung und Qualität inklusiven Mathematikunterrichts auf der Primarstufe
10. 1. 1 Klassenführung
10. 1. 2 Sozial-emotionale Unterstützung von Schüler*innen mit intellektueller Beeinträchtigung
10. 1. 3 Inhaltsbezogene Unterstützung der Schüler*innen
10. 1. 4 Merkmalsbasierte Cluster und Typen im inklusiven Mathematikunterricht
10. 1. 5 Nested instruction in inklusiven Settings mit multiprofessionellen Klassenteams
10. 1. 6 Implikationen für die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagog*innen
10. 2 Diskussion des methodischen Vorgehens
10. 2. 1 Datenerhebung
10. 2. 2 Einschätzung der entwickelten Instrumente für die Videodatenauswertung
10. 2. 3 Grenzen der Studie
10. 3 Ansätze und Fragen für die weitere Forschung
11. Literaturverzeichnis
12. Tabellenverzeichnis
13. Abbildungsverzeichnis
14. Anhang
14. 1 Basiscodierung: Auszug aus dem Kategoriensystem zur Lektionsdauer und den Sozialformen
14. 2 Niedrig inferentes Kategoriensystem Auszüge
14. 2. 1 Organisation des sozialen Interaktionsraums für Kinder mit und ohne intellektuelle Beeinträchtigung
14. 2. 2 Ausmaß an interaktiver Begleitung von Kindern mit intellektueller Beeinträchtigung
14. 2. 3 Sozialformen des gelenkten Unterrichts mit Fokus auf Kinder mit intellektueller Beeinträchtigung
14. 2. 4 Inhaltliche Aktivitäten
14. 2. 5 Auszug aus den allgemeinen Codierhinweisen für alle niedrig inferenten Codierungen
14. 3 Mittel inferentes Kategoriensystem Auszüge
14. 4 Hoch inferentes Ratingsystem Auszüge
Produktdetails
Erscheinungsdatum
17. März 2025
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
515
Autor/Autorin
Helena Krähenmann
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Gewicht
746 g
Größe (L/B/H)
210/148/32 mm
ISBN
9783966650908
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Qualität inklusiven Mathematikunterrichts in der Primarschule" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.







