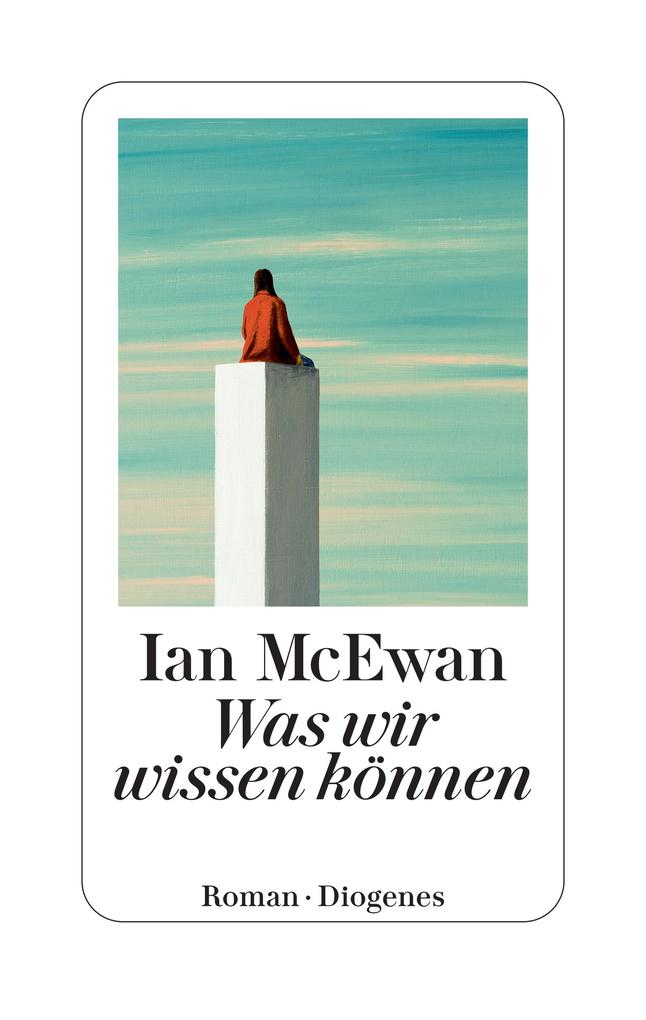Thomas Metcalfe ist Literaturwissenschaftler, lebt in einer Welt aus Inseln, es ist das Jahr 2119. Seine Leidenschaft, oder vielmehr Obsession, gehört dem "Sonettenkranz für Vivien", der über hundert Jahr zuvor bei einer Feierlichkeit anlässlich des Geburtstags von Vivien Blundy, Frau des verfassenden Literarten, vorgetragen wurde und seitdem als verschwunden gilt. Thomas recherchiert intensiv und nach all den gegebenen Möglichkeiten, um den Gedichtzyklus aufzuspüren, doch während sich die Welt in der er lebt, um drängendere Probleme kümmert, zeigen sich für die Leser*innen ungeahnte Vorkommnisse, welche die Wahrheit in ein anderes Licht rücken lässt.
Ian McEwans Buch "Was wir wissen können" zu bewerten, fällt mir nicht leicht. Es war das erste Buch, dass ich von dem wohlbekannten Autor gelesen habe und bin froh, es nicht mit Vorgängerwerken vergleichen zu müssen. Ich bin hin und her gerissen zwischen Gefallen und Unbehagen - aber je länger das Buch nachwirkt, desto mehr entfalten sich Aspekte, die mich schlicht begeistern. Aber von vorn:
Beim ersten Teil des Buches verfolgen wir die Obsession Thomas Metcalfes - seine Gedanken drehen sich stets um den verschollenen Sonettenkranz, vielmehr um Details zu dem Abendessen, an dem dieser vorgetragen wurde - und auch, aber eher hintergründig, um seine Beziehung zu seiner Kollegin Rose. Diesen Teil fand ich irrsinnig mühsam und in großen Stellen langweilig, auch wenn mich die Sequenzen, in denen über die "Gegenwart" (also das Jahr 2119) sehr faszinierten - wie McEwan die Welt in der Zukunft malt, finde ich sehr interessant und realistisch. Die Kunst, die er einlegt, ist, dass die Welt wie sie geworden ist, nicht vordergründig erzählt wird, sondern in Beisätzen, in kleinen Schaubildern, die der Autor in die Storyline einarbeitet. Diese Sequenzen waren für mich der Anker, der mich dazu veranlasst hat, weiterzulesen (auch wenn ich ob der ausufernden Beschreibung um Francis und Vivien Blundys Festmahl das Buch regelmäßig weg legen musste). Dann der große Bruch: wir lesen nun aus der Sicht von Vivien Blundy, sind also in die erst geschehene Vergangenheit geworfen worden. Hier ändert sich der Stil schlagartig, staunend lesen wir über Blundys Liebesleben - ihre Ehen, Affären und einschneidende Erlebnisse, die so nicht zu erwarten waren. Der Teil ist sehr kurzweilig geschrieben, keine Langeweile mehr, erklärt vieles, gibt aber auch ausreichend Platz zum Spekulieren für die Lesenden. Trotzdem die Fadesse verschwunden war, staunte ich über das Erzählte sehr, denn der Duktus hatte sich so erheblich geändert, dass ich mir gar nicht mehr sicher war, ob diese Vivien Blundy-Welt tatsächlich vom selben Autor stammte. Oft blieb ich irritiert zurück.
Als ich das Buch beendet habe, dachte ich mir: nö, das war ja jetzt gar nicht meins. Der Nachhall belehrte mich aber eines Besseren. Ich hatte das Glück an einer Leserunde teilzunehmen und wir diskutierten das Buch wirklich intensiv. Je mehr wir diskutierten und je mehr Zeit nach Beendigung vergingen, desto mehr begann mich das Buch zu überzeugen, die kleinen Details über die Zukunftsszenarien, die Frage, was der Autor uns jetzt eigentlich mit allem sagen will, die Frage nach der Wahrheit, die es doch so eigentlich gar nicht geben kann. Was wissen wir denn wirklich schon und was können wir denn eigentlich tatsächlich wissen? So sind es viele kleine Themen, die der Autor geschickt versteckt angeht, seine Kunst ist es, die Komplexität des Menschseins aufzudröseln, auch in Nebensächlichkeiten. Mittlerweile empfinde ich das Buch als äußerst geschickte Komposition, die zwischen der Absurdität und Genialität der Menschheit liegt, wobei erstere definitiv die Oberhand behält. Ich kann mir vorstellen, dass "Was wir wissen können" eines jener Bücher sein wird, dass mich sehr lange gedanklich begleiten wird. Ein Stern wird trotzdem abgezogen, für die zähen Stunden die ich mit lesender Langeweile verbringen musste.
Mein Fazit: "Was wir wissen können" ist ein Roman, der erst im Nachhall zur vollen Entfaltung kommt. Ich empfehle jedem*r, der/die sich an das Buch heranwagt, es gemeinsam mit anderen zu tun, denn seine vielfältigen Dimensionen und auch seine Großartigkeit kommen erst in der Diskussion voll zur Geltung. Der komplette Erkenntnisgewinn bleibt aber aus und das ist gut so, Hauptsache wir wissen: wir wissen nichts.