NEU: Das eBook.de Hörbuch Abo - jederzeit, überall, für nur 7,95 € monatlich!
Jetzt entdecken
mehr erfahren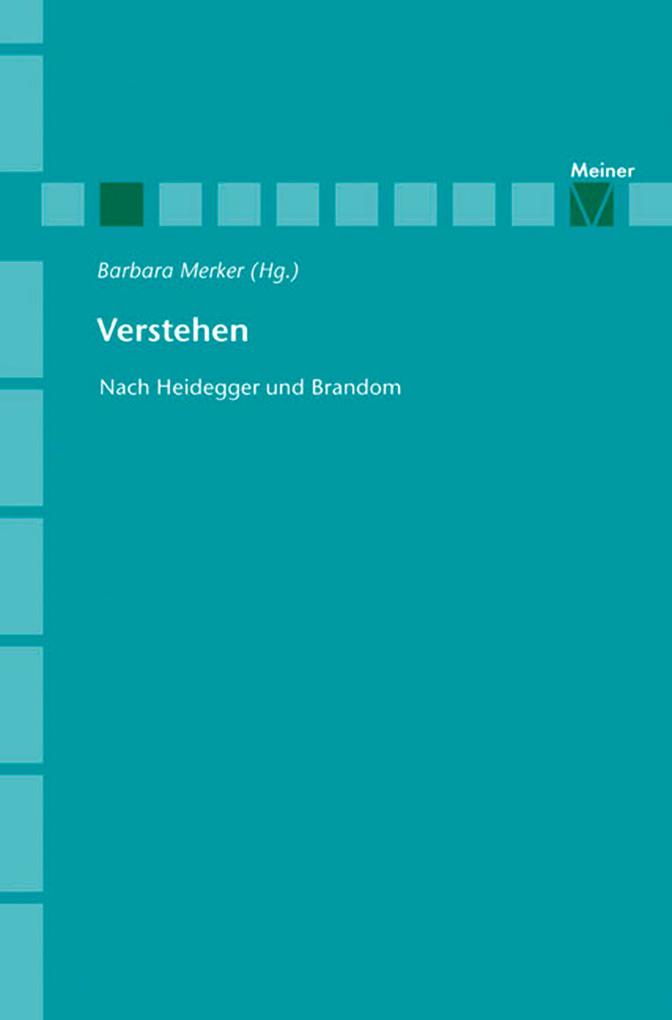
Sofort lieferbar (Download)
Was ist Verstehen? Welche Theorie des Verstehens ist plausibel? Was können wir verstehen? Was sind Bedeutungen? Welche Rolle spielen Rationalität, Normativität, Sozialität, Perzeptibilität, Historizität, Lingualität und Inferentialität beim Verstehen? Ist Verstehen stets begrifflich, sprachlich, propositional, oder gibt es auch unbegriffliches, vorsprachliches, nicht-propositionales Verstehen? Ist Verstehen eine Form von Wissen, und wie verhält es sich zu anderen Formen des Wissens?
Das sind die Themen, mit denen sich die Beiträge dieses Bandes befassen, und zwar fokussiert auf zwei Positionen aus dem Spektrum der Hermeneutiken, Semantiken und Epistemologien, die auf die angeführten Fragen Antworten offerieren: Die Positionen von Martin Heidegger und Robert Brandom, der sich aus (post-)analytischer Perspektive ausdrücklich mit dem Begriff des Verstehens in »Sein und Zeit« auseinandersetzt.
Das sind die Themen, mit denen sich die Beiträge dieses Bandes befassen, und zwar fokussiert auf zwei Positionen aus dem Spektrum der Hermeneutiken, Semantiken und Epistemologien, die auf die angeführten Fragen Antworten offerieren: Die Positionen von Martin Heidegger und Robert Brandom, der sich aus (post-)analytischer Perspektive ausdrücklich mit dem Begriff des Verstehens in »Sein und Zeit« auseinandersetzt.
Inhaltsverzeichnis
1;INHALT;6 2;EINLEITUNG;8 3;Diskursive Kontoführung als bedeutungskonstitutive Praxis des Verstehens;18 3.1;1.;19 3.2;2.;23 3.3;3.;26 4;Zur Rolle der Sprache in Sein und Zeit;28 4.1;1. In-der-Welt-sein;29 4.2;2. Verstehen und Auslegung;32 4.3;3. Rede als Artikulation der Verständlichkeit;34 4.4;4. Heidegger als sprachphilosophischer Pragmatist;36 4.5;5. Rede und Sprache;38 4.6;6. Die semantische Dimension von Rede und Sprache;41 4.7;7. Die soziale Dimension von Rede und Sprache;44 4.8;8. Sprache und Welterschließung;45 5;Verstehen und Auslegung bei Heidegger;48 6;Implizit und Explizit;62 6.1;I. Verstehen bei Heidegger;63 6.2;II. Verstehen bei Brandom;68 6.3;III. Verstehen, Begriffe, Propositionen;76 7;Dimensionen des Verstehens;80 8;Ein individualistischer Blick auf normativistische Erklärungsansprüche und das Soziale bei Heidegger;96 8.1;1. Einleitung;96 8.2;2. Normatives Vokabular und der Verdacht eines Erklärungszirkels;98 8.3;3. Das Soziale in Heideggers Überlegungen zur Sprache;102 9;Verstehen und Klassifizieren: Drei Probleme mit Brandom- Heidegger;130 9.1;1. Diskriminieren und Klassifizieren;131 9.2;2. Begriffliches Diskriminieren und Klassifizieren;133 9.3;3. Zweideutigkeiten: Der Anfang der Klassifikation und die Prioritätsverhältnisse zwischen Zuhandenem und Vorhandenem, Zuhandenheit und Vorhandenheit;134 9.4;4. Begriffliche versus unbegriffliche Klassifikation;141 9.5;5. Geeignetheiten oder soziale Angemessenheiten? Instrumentalismus versus Sozialpragmatismus;143 10;Making It Explicit und die Priorität des Zuhandenengegen über dem Vorhandenen;148 10.1;1. Zuhandenes und Vorhandenes bei Brandoms Heidegger;149 10.2;2. Was entspricht in MIE dem Zuhandenen und dem Vorhandenen?;154 10.3;3. Die Priorität des normativen gegenüber dem nicht-normativen Vokabular in MIE;156 10.4;4. Zwei Probleme;158 11;Zum Verhältnis von symbolbezogenen und nicht- symbolbezogenen Formen des Verstehens;166 11.1;I.;167 11.2;II.;170 11.3;III.;180 11.4;IV.;185 12;Die Kontextualität des
Verstehens in Heideggers Daseinshermeneutik und Brandoms inferentialistischer Heidegger- Interpretation;192 12.1;1. Der kontextuelle Charakter des Verstehens (Husserl);193 12.2;2. Der sozialpragmatische Charakter des Verstehenskontextes ( Heidegger);198 12.3;3. Der kommunikative Charakter der Verstehenspraxis (Brandom);204 13;Brandom and Two Problems of Conceptual Role Semantics;212 13.1;I;212 13.2;II;215 13.3;III;219 13.4;IV;225 13.5;V;227 14;Inferentialism and the Content of Perception;234 14.1;I. Introduction;248 14.2;II. From Dennetts Stance to Brandoms Rationality;250 14.3;III. The Foundations of Rationality;252 14.4;IV. Clarifying Analogies;258 14.5;V. Dissolving Rationality;260 14.6;VI. Conclusions;262 15;GESAMTBIBLIOGRAPHIE;264 16;BIOGRAPHISCHE NOTIZEN;272
Verstehens in Heideggers Daseinshermeneutik und Brandoms inferentialistischer Heidegger- Interpretation;192 12.1;1. Der kontextuelle Charakter des Verstehens (Husserl);193 12.2;2. Der sozialpragmatische Charakter des Verstehenskontextes ( Heidegger);198 12.3;3. Der kommunikative Charakter der Verstehenspraxis (Brandom);204 13;Brandom and Two Problems of Conceptual Role Semantics;212 13.1;I;212 13.2;II;215 13.3;III;219 13.4;IV;225 13.5;V;227 14;Inferentialism and the Content of Perception;234 14.1;I. Introduction;248 14.2;II. From Dennetts Stance to Brandoms Rationality;250 14.3;III. The Foundations of Rationality;252 14.4;IV. Clarifying Analogies;258 14.5;V. Dissolving Rationality;260 14.6;VI. Conclusions;262 15;GESAMTBIBLIOGRAPHIE;264 16;BIOGRAPHISCHE NOTIZEN;272
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
01. Januar 2009
Sprache
deutsch
Auflage
Unverändertes eBook der 1. Auflage von 2009
Seitenanzahl
274
Dateigröße
1,47 MB
Reihe
Phänomenologische Forschungen - Beihefte, 3
Herausgegeben von
Barbara Merker
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
PDF
ISBN
9783787320844
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Aufgrund der insgesamt hohen Qualität der Beiträge bietet der Band wichtige und anregende Lektüre für Philosophinnen und Philosophen, die an der Weiterentwicklung einer analytisch informierten Heidegger-Deutung interessiert sind, sowie für solche, die generell zu den begrifflichen Zusammenhängen von Praxis, Welt und Sprache arbeiten." Die ganze Besprechung finden Sie auf der im September 2009 neu online gegangenen integrativen rezensionszeitschrift r:k:m unter http://www. rkm-journal. de/archives/1411. «
r:k:m
r:k:m
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Verstehen" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.










