NEU: Das eBook.de Hörbuch Abo - jederzeit, überall, für nur 7,95 € monatlich!
Jetzt entdecken
mehr erfahren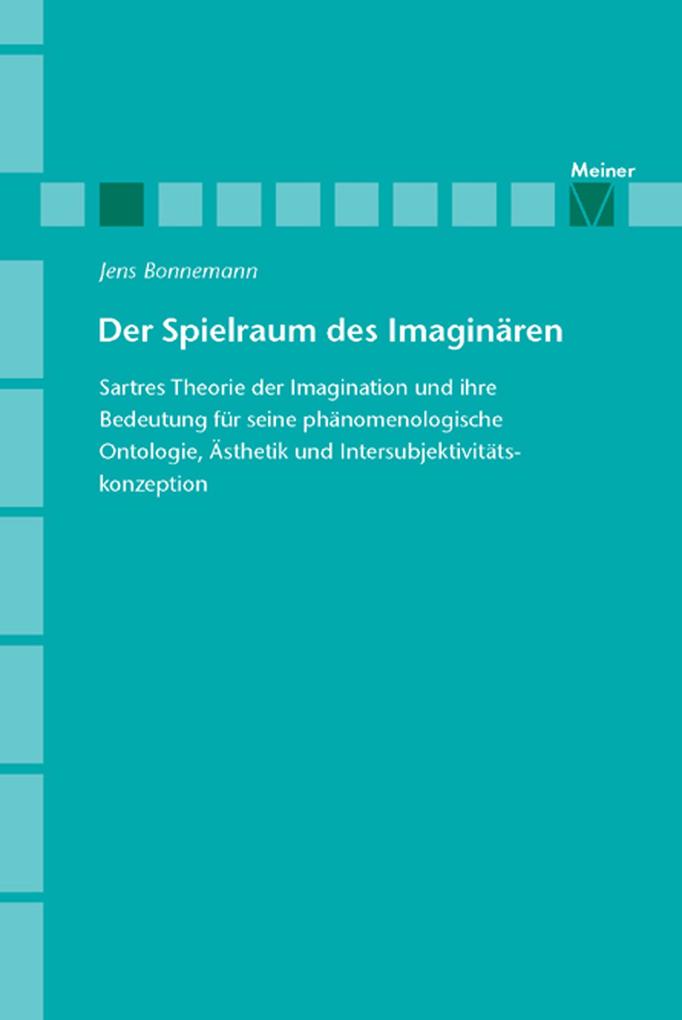
Sofort lieferbar (Download)
Jens Bonnemann widmet sich Sartres Theorie der Imagination. Angesichts der nach wie vor regen Beschäftigung mit diesem paradoxerweise seit Jahrzehnten 'totgesagten' Philosophen, wundert es, daß seine Imaginationslehre bisher wenig Beachtung fand. Dies ist um so erstaunlicher, da Sartre dieses Thema ebenso ausgiebig behandelt wie die Probleme Freiheit, Subjektivität, (literarisches und politisches) Engagement oder Intersubjektivität. Sartres Imaginationstheorie, die auf phänomenologische Weise das Verhältnis von Imagination und Wahrnehmung, Irrealität und Realität zu bestimmen versucht, ist durchaus im Kontext aktueller philosophischer Debatten von großem Interesse, in denen die vermeintliche Fiktionalität des Realen verhandelt wird.
Inhaltsverzeichnis
1;INHALTSVERZEICHNIS;6 2;EINLEITUNG;12 3;Vorüberlegungen zum Forschungsstand;21 4;1. DIE AUSEINANDERSETZUNG MIT DER PHILOSOPHIEGESCHICHTLICHEN TRADITION;36 4.1;1. 1. Phänomenologische Vorüberlegungen und die ontologische Differenz von Bewußtsein und Gegenstand;37 4.2;1. 2. Die rationalistische Auffassung des Bildes;43 4.3;1. 3. Die empiristische Auffassung des Bildes;48 4.4;1. 4. Die Gegebenheit des Bildes ist keine Leistung des Urteilsvermögens;53 4.5;1. 5. Husserls Phänomenologie;62 4.6;1. 6. Die Kritik an Husserls Phänomenologie der Imagination;68 5;2. DIE SYSTEMATISCHE ENTFALTUNG DER THEORIE DER EINBILDUNGSKRAFT;76 5.1;2. 1. Die vier Grundcharakteristiken;78 5.2;2. 2. Die Funktion des Analogons in der Vorstellung;98 5.3;2. 3. Imagination und Denken;114 5.4;2. 4. Imagination und Wahrnehmung;117 5.5;2. 5. Das Verhalten gegenüber dem irrealen Objekt;125 5.6;2. 6. Die Halluzination als Gegen-Spontaneität (Im 249);134 5.7;2. 7. Der Traum;142 5.8;2. 8. Imagination und Freiheit;145 5.9;2. 9. Imagination und Ästhetik I;149 6;3. DIE RÜCKKEHR IN DIE HÖHLE PLATONS: DER ONTOLOGISCHE BEWEIS;162 6.1;3. 1. Phänomenologische Reduktion als Zurückweisung noumenaler Realitäten;164 6.2;3. 2. Die Nicht-Reduzierbarkeit des Seins des Phänomens auf das Seinsphänomen;167 6.3;3. 3. Das Sein des percipiens ist transphänomenal;169 6.4;3. 5. Der ontologische Beweis;174 6.5;3. 6. Die Beschreibung des Seinsphänomens und der Dualismus von Für- sich und An- sich;177 7;4. DIE DIFFERENZ VON WAHRNEHMUNG UND IMAGINATION ALS BEDINGUNG DER FREIHEITSKONZEPTION;182 8;5. REALISMUS UND KONSTITUTION;192 9;6. IMAGINATION UND ÄSTHETIK II;206 9.1;6. 1. Das literarische Kunstwerk als Appell an die Freiheit des Lesers;209 9.2;6. 2. Das Auftauchen eines neuen Imaginationsparadigmas in der Gegenüberstellung von Poesie und Prosa;223 10;7. BLICK, AN- SICH- FÜR- SICH- SEIN UND ROLLE;242 11;8. REALISIERENDE ODER IRREALISIERENDE INTERSUBJEKTIVE KONSTITUTION DES SUBJEKTS;286 11.1;8. 1. Rekonstruktion der archaischen G
rundlagen der Sensibilität ( sensibilité) ( IF 1, 54) Valorisierung oder Nicht- Valorisierung durch die Säuglingspflege;288 11.2;8. 2. Glaube und Wissen;299 11.3;8. 3. Valorisierung als Verbalisierung bzw. Unfähigkeit zu Handeln als Leseschwäche;308 11.4;8. 4. Schauspielerei als Folge der Passivität;317 11.5;8. 5. Die Wechselseitigkeit als ursprüngliches Verhältnis zum Anderen;320 12;9. IRREALISIERUNG ZWISCHEN SCHAUSPIELEREI UND MISSACHTUNG ;326 12.1;9. 1. Phänomenologie des Lachens als Nicht-Valorisierung bzw. Irrealisierung;326 12.2;9. 2. Der Komiker als Märtyrer der Irrealität (IF 2, 153);332 12.3;9. 3. Ausweitung der Lächerlichkeit auf die Menschheit;339 12.4;9. 4. Widersprüchlichkeiten infolge der Äquivokation des Imaginationsbegriffs;341 12.5;9. 5. Bestimmung und Abgrenzung von drei unterschiedlichen Auffassungen des Imaginären;349 12.6;9. 6. Die Rolle des Nicht-seins im Verhältnis zu den drei Imaginationsformen und ihren anthropologischen Grundvoraussetzungen;351 12.7;9. 7. Die diachrone und die synchrone Ebene der Irrealisierung;354 13;10. IMAGINATION UND ÄSTHETIK III;364 13.1;10. 1. Die ästhetische Einstellung als antihumanistische Bedingung der Kunstproduktion;364 13.2;10. 2. Die ästhetische Einstellung als Gegenarbeit;377 13.3;10. 3. Vom Ästheten zum Künstler;388 13.4;10. 4. Dichter und Künstler;390 13.5;10. 5. Ästhetische Sprachverwendung das Wort als Sprungbrett des Traums ( IF 4, 246);395 14;11. DAS IMAGINÄRE ALS GESELLSCHAFTLICHE STRUKTUR;422 14.1;11. 1. Die objektiven Imperative der geschaffenen Literatur;425 14.2;11. 2. Neurose-Kunst;436 14.3;11. 3. Das irreale Publikum;442 14.4;11. 4. Sartre als Nachromantiker;455 15;12. DIE DIALEKTISCHE ANTHROPOLOGIE UND DIE REGRESSIV- PROGRESSIVE METHODE DES VERSTEHENS;462 15.1;12. 1. Kritik des orthodoxen Marxismus;463 15.2;12. 2. Das hermeneutische Programm der Flaubert-Studie;469 15.3;12. 3. Die implizite Erweiterung des Begriffs des Subjekt- Anderen in Der Idiot der Familie;480 16;SCHLUSSBEMERKUNGEN;488 17;LI
TERATURVERZEICHNIS;506
rundlagen der Sensibilität ( sensibilité) ( IF 1, 54) Valorisierung oder Nicht- Valorisierung durch die Säuglingspflege;288 11.2;8. 2. Glaube und Wissen;299 11.3;8. 3. Valorisierung als Verbalisierung bzw. Unfähigkeit zu Handeln als Leseschwäche;308 11.4;8. 4. Schauspielerei als Folge der Passivität;317 11.5;8. 5. Die Wechselseitigkeit als ursprüngliches Verhältnis zum Anderen;320 12;9. IRREALISIERUNG ZWISCHEN SCHAUSPIELEREI UND MISSACHTUNG ;326 12.1;9. 1. Phänomenologie des Lachens als Nicht-Valorisierung bzw. Irrealisierung;326 12.2;9. 2. Der Komiker als Märtyrer der Irrealität (IF 2, 153);332 12.3;9. 3. Ausweitung der Lächerlichkeit auf die Menschheit;339 12.4;9. 4. Widersprüchlichkeiten infolge der Äquivokation des Imaginationsbegriffs;341 12.5;9. 5. Bestimmung und Abgrenzung von drei unterschiedlichen Auffassungen des Imaginären;349 12.6;9. 6. Die Rolle des Nicht-seins im Verhältnis zu den drei Imaginationsformen und ihren anthropologischen Grundvoraussetzungen;351 12.7;9. 7. Die diachrone und die synchrone Ebene der Irrealisierung;354 13;10. IMAGINATION UND ÄSTHETIK III;364 13.1;10. 1. Die ästhetische Einstellung als antihumanistische Bedingung der Kunstproduktion;364 13.2;10. 2. Die ästhetische Einstellung als Gegenarbeit;377 13.3;10. 3. Vom Ästheten zum Künstler;388 13.4;10. 4. Dichter und Künstler;390 13.5;10. 5. Ästhetische Sprachverwendung das Wort als Sprungbrett des Traums ( IF 4, 246);395 14;11. DAS IMAGINÄRE ALS GESELLSCHAFTLICHE STRUKTUR;422 14.1;11. 1. Die objektiven Imperative der geschaffenen Literatur;425 14.2;11. 2. Neurose-Kunst;436 14.3;11. 3. Das irreale Publikum;442 14.4;11. 4. Sartre als Nachromantiker;455 15;12. DIE DIALEKTISCHE ANTHROPOLOGIE UND DIE REGRESSIV- PROGRESSIVE METHODE DES VERSTEHENS;462 15.1;12. 1. Kritik des orthodoxen Marxismus;463 15.2;12. 2. Das hermeneutische Programm der Flaubert-Studie;469 15.3;12. 3. Die implizite Erweiterung des Begriffs des Subjekt- Anderen in Der Idiot der Familie;480 16;SCHLUSSBEMERKUNGEN;488 17;LI
TERATURVERZEICHNIS;506
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
01. Juni 2007
Sprache
deutsch
Auflage
Unverändertes eBook der 1. Auflage von 2007
Seitenanzahl
524
Dateigröße
1,79 MB
Reihe
Phänomenologische Forschungen - Beihefte, 2
Autor/Autorin
Jens Bonnemann
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
PDF
ISBN
9783787320196
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Der Spielraum des Imaginären" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.










