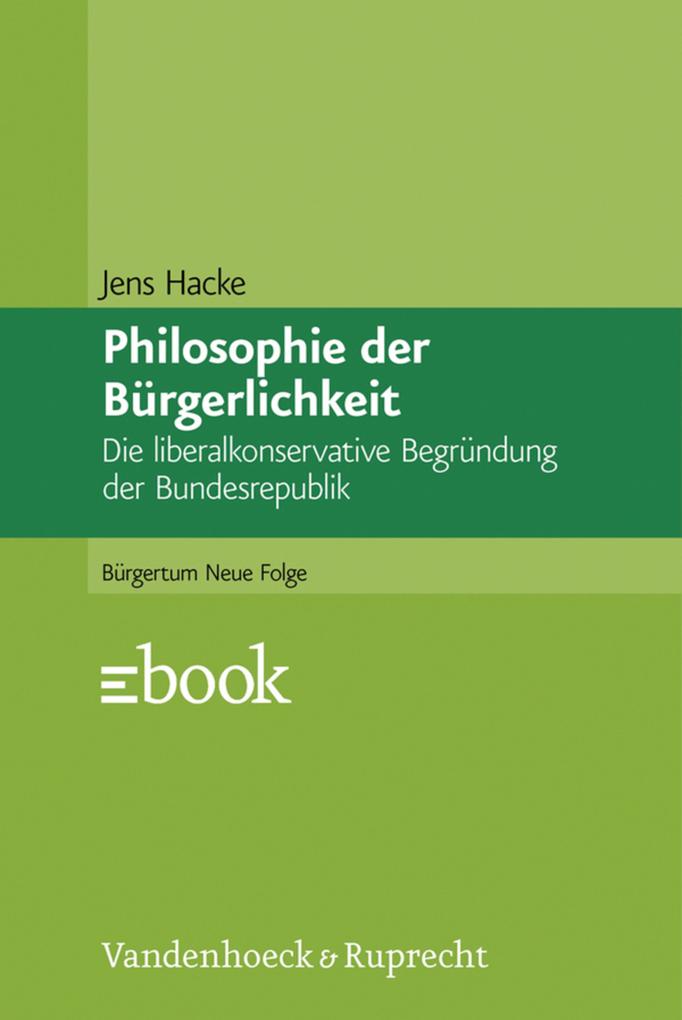
Sofort lieferbar (Download)
Die Geschichte der Bundesrepublik besitzt eine nachträgliche intellektuelle Begründung. Sie ist sichtbar in einer bürgerlichen Haltung, die sich mit dem westdeutschen Staat in seinen Grundsätzen identifizierte. Philosophisch wurde diese Position vor allem von einem Kreis um Joachim Ritter formuliert, zu dem Hermann Lübbe, Odo Marquard und auch Robert Spaemann gehörten. Ihre Philosophie der Bürgerlichkeit speist sich aus einer liberal gewendeten konservativ-antidemokratischen deutschen Tradition eines Carl Schmitt und Arnold Gehlen. Jens Hacke rekonstruiert diese politische Philosophie, deren Grundlinien sich in der Aufarbeitung ihrer Traditionen, aber auch in Auseinandersetzung mit der kritischen Gesellschaftstheorie eines Jürgen Habermas ausgeformt haben.
Inhaltsverzeichnis
1;Inhalt;6 2;Vorwort;10 3;I. Einleitung;12 4;II. Ausgangspunkte;28 4.1;1. Die erste politische Generation der Bundesrepublik;28 4.1.1;Schelskys skeptische Generation: Funktionalität und Konkretismus;32 4.1.2;Das Collegium Philosophicum in Münster;36 4.2;2. Geschichtsbegriff und Geschichtsinteresse;46 4.2.1;Kritik der Geschichtsphilosophie;49 4.2.2;Die liberale Auslegung Hegels und ihre Folgen;53 4.2.3;Revitalisierung des Historismus;58 4.2.4;Kultur der Kontingenzerfahrung als Apologie des Zufälligen;62 4.2.5;Historische Identität und Identitätspräsentation;66 4.2.6;Das historische Gesetz der Kompensation;71 4.2.7;Inkompensable Vergangenheit der Nationalsozialismus in der deutschen Geschichte;80 4.2.8;Geschichtsdenken und politisches Denken;93 4.3;3. Politische Formierung des Liberalkonservatismus nach 1968;95 4.3.1;Stationen des politischen Engagements;101 4.3.2;Intellektuelle Kritik und Intellektuellenkritik;117 4.3.3;Konservatives Selbstverständnis;129 5;III. Bausteine einer politischen Philosophie;136 5.1;1. Grundlagen liberalkonservativer Institutionentheorie;137 5.1.1;Arnold Gehlen: Stabilisierung und Entlastung durch Institutionen;141 5.1.2;Helmut Schelsky: Institutionalisierte Reflexion und Transformation;148 5.1.3;Zur Kritik des Institutionenmodells nach Gehlen und Schelsky;154 5.1.4;Liberaldemokratische Institutionen als Ordnungsrahmen;158 5.1.5;Joachim Ritter:Ethische Institutionen im Anschluß an Aristoteles und Hegel;162 5.1.6;Widerstandsrecht und ziviler Ungehorsam;167 5.1.7;Die Aktivierung der Beweislastverteilungsregel;171 5.2;2. Im Handlungsraum der Institutionen: Pragmatischer Dezisionismus;175 5.2.1;Reaktualisierung des Dezisionismus aus dem Geist der Klassiker:Descartes, Hobbes und Kant;180 5.2.2;Carl Schmitt liberal rezipiert;185 5.2.3;Rehabilitation des Dezisionismus als Technokratiekritik;190 5.2.4;Kritik der Diskurstheorie;195 5.2.5;Das Programm des pragmatischen Dezisionismus;205 5.2.6;Dezisionismus: Kritik und Reichweite;211 5.3;3. Orientieru
ngen: Common Sense und Zivilreligion;216 5.3.1;Die traditional bewährte Erfahrung des Common sense;221 5.3.2;Die Krise des Common sense: Herrschaft der instrumentellen Vernunft?;226 5.3.3;Common sense als moralische Orientierung;232 5.3.4;Freund/Feind-Unterscheidungen durch: Common sense;236 5.3.5;Die Suspension der Moralbegründung;241 5.3.6;Moralisch-legitimatorischer Minimalkonsens durch Zivilreligion;246 5.4;4. Eine Philosophie der Bürgerlichkeit;257 5.4.1;Die Apologie bürgerlicher Lebenswelten;261 5.4.2;Odo Marquard und Richard Rorty: Das bürgerliche Projekt der Moderne;270 5.4.3;Eine Philosophie der Nichtidentität?;276 5.4.4;Liberalkonservative Bürgerlichkeit im Kontext neuerer Diskussion;283 6;IV. Schlußbetrachtung;292 7;V. Literatur;302 8;VI. Register;322
ngen: Common Sense und Zivilreligion;216 5.3.1;Die traditional bewährte Erfahrung des Common sense;221 5.3.2;Die Krise des Common sense: Herrschaft der instrumentellen Vernunft?;226 5.3.3;Common sense als moralische Orientierung;232 5.3.4;Freund/Feind-Unterscheidungen durch: Common sense;236 5.3.5;Die Suspension der Moralbegründung;241 5.3.6;Moralisch-legitimatorischer Minimalkonsens durch Zivilreligion;246 5.4;4. Eine Philosophie der Bürgerlichkeit;257 5.4.1;Die Apologie bürgerlicher Lebenswelten;261 5.4.2;Odo Marquard und Richard Rorty: Das bürgerliche Projekt der Moderne;270 5.4.3;Eine Philosophie der Nichtidentität?;276 5.4.4;Liberalkonservative Bürgerlichkeit im Kontext neuerer Diskussion;283 6;IV. Schlußbetrachtung;292 7;V. Literatur;302 8;VI. Register;322
Produktdetails
Erscheinungsdatum
19. März 2008
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
323
Reihe
Bürgertum Neue Folge
Autor/Autorin
Jens Hacke
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
ohne Kopierschutz
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
PDF
ISBN
9783647368429
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Philosophie der Bürgerlichkeit" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.







