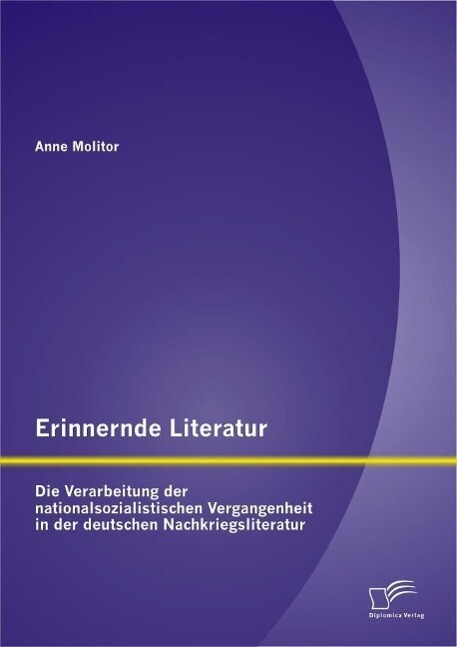
Sofort lieferbar (Download)
Fast siebzig Jahre nach dem Untergang des Dritten Reiches stehen die Jahre der totalitären Diktatur noch immer im Zentrum des zeithistorischen Interesses.
Die in den 1990ern ausgetragene Debatte um die Errichtung des Holocaust-Mahnmals in Berlin sowie die mediale Präsenz der Thematik zeugen von einem regelrechten Gedächtnis-Boom an der Schwelle des 21. Jahrhunderts.
Das allmähliche Wegfallen der Zeitzeugen-Generation kann als einer der Hauptfaktoren für die Brisanz des gegenwärtigen Erinnerungsdiskurses betrachtet werden. Wir befinden uns unmittelbar vor einem Generationswechsel, der uns vor eine Reihe von Herausforderungen stellt: Die wichtigste aber auch heikelste Herausforderung besteht darin, trotz des fehlenden direkten Bezuges, die erfolgreiche Übermittlung der Erfahrungen der nationalsozialistischen Vergangenheit an die zukünftigen Generationen zu garantieren.
Die Walser-Bubis-Debatte Ende der 1990er Jahre hat gezeigt, dass es im Erinnerungsdiskurs des ausgehenden 20. Jahrhunderts, neben der Frage nach der Zukunft des Erinnerungsdiskurses, vor allem um die Diskussion über eine verantwortungsbewusste Erinnerungsform gegenüber den verschiedenen Opfergruppen geht.
In dieser Untersuchung soll nun folgenden Fragestellungen nachgegangen werden:
In welchem Maß wurde die Literatur der verschiedenen Nachkriegsgenerationen dieser Forderung gerecht? Welchen Entwicklungsprozess hat der Erinnerungsdiskurs über die Generationen hinweg durchgemacht? Welche Rolle kann oder muss die Literatur in dieser Problematik übernehmen? Und welchen Beitrag kann sie für eine adäquate Erinnerungsübermittlung an die kommenden Generationen leisten?
Die in den 1990ern ausgetragene Debatte um die Errichtung des Holocaust-Mahnmals in Berlin sowie die mediale Präsenz der Thematik zeugen von einem regelrechten Gedächtnis-Boom an der Schwelle des 21. Jahrhunderts.
Das allmähliche Wegfallen der Zeitzeugen-Generation kann als einer der Hauptfaktoren für die Brisanz des gegenwärtigen Erinnerungsdiskurses betrachtet werden. Wir befinden uns unmittelbar vor einem Generationswechsel, der uns vor eine Reihe von Herausforderungen stellt: Die wichtigste aber auch heikelste Herausforderung besteht darin, trotz des fehlenden direkten Bezuges, die erfolgreiche Übermittlung der Erfahrungen der nationalsozialistischen Vergangenheit an die zukünftigen Generationen zu garantieren.
Die Walser-Bubis-Debatte Ende der 1990er Jahre hat gezeigt, dass es im Erinnerungsdiskurs des ausgehenden 20. Jahrhunderts, neben der Frage nach der Zukunft des Erinnerungsdiskurses, vor allem um die Diskussion über eine verantwortungsbewusste Erinnerungsform gegenüber den verschiedenen Opfergruppen geht.
In dieser Untersuchung soll nun folgenden Fragestellungen nachgegangen werden:
In welchem Maß wurde die Literatur der verschiedenen Nachkriegsgenerationen dieser Forderung gerecht? Welchen Entwicklungsprozess hat der Erinnerungsdiskurs über die Generationen hinweg durchgemacht? Welche Rolle kann oder muss die Literatur in dieser Problematik übernehmen? Und welchen Beitrag kann sie für eine adäquate Erinnerungsübermittlung an die kommenden Generationen leisten?
Inhaltsverzeichnis
1;Erinnernde Literatur: Die Verarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit in der deutschen Nachkriegsliteratur;1 1.1;Inhaltsverzeichnis;3 1.2;1 Problemstellung;5 1.2.1;1.1 Problemlage und Zielsetzung;5 1.2.2;1.2 Forschungsüberblick;10 1.2.3;1.3 Theoretische Grundlage;11 1.2.3.1;1.3.1 Das kommunikative und das kulturelle Gedächtnis als Formen des kollektiven Gedächtnisses;14 1.3;2 Die Generation der Zeitzeugen40;18 1.3.1;2.1 Die Walser-Bubis-Debatte;21 1.3.1.1;2.1.1 Martin Walsers Forderung nach einer autonomen Erinnerungsform;22 1.3.1.2;2.1.2 Ignatz Bubis Gedenkrede zur Reichspogromnacht als kritische Replik aufWalsers Postulat;25 1.3.1.3;2.1.3 Das Problem literarischer Sprache in einem politisch konnotierten Werk;28 1.3.2;2.2 Martin Walser: Ein springender Brunnen;32 1.3.2.1;2.2.1 Die Problematik des Romans;32 1.3.2.2;2.2.2 Martin Walsers Erinnerungspoetik: Solange etwas ist, ist es nicht das, was esgewesen sein wird (SB 99);35 1.3.2.3;2.2.3 Ein springender Brunnen als literarischer Versuch der objektiven Erinnerung;37 1.3.2.4;2.2.4 Walsers Erinnerungspoetik und die kulturwissenschaftliche Gedächtnistheorie;39 1.3.2.5;2.2.5 Walsers autobiographischer Roman Ein springender Brunnen als Ausdruck seinerpersönlichen Beziehung zum Nationalsozialismus;42 1.3.2.6;2.2.6 Die Sprache im Kontext des persönlichen Autonomieanspruchs;45 1.3.2.7;2.2.7 Der Vorwurf der idealisierenden Darstellung der Vergangenheit in der zeitgenössischenRezeption;46 1.3.3;2.3 Ruth Klüger: weiter leben, Eine Jugend.;48 1.3.3.1;2.3.1 Versuch eines Dialoges: Den Göttinger Freunden...ein deutsches Buch;48 1.3.3.2;2.3.2 Ruth Klüger und Martin Walser ein typisch jüdisch-deutsches Verhältnis?;49 1.3.3.3;2.3.3 Die Darstellung der Erinnerung als Konstruktion in weiter leben. Eine Jugend.;52 1.3.3.4;2.3.4 Diskrepanz zwischen der Notwendigkeit und der Unmöglichkeit der sprachlichen Ausdruckskraft nach 1945 ;56 1.3.3.5;2.3.5 Die Rezeption der deutschen Gesellschaft Annahme des Dialogangebots?;57 1.3.4;
2.4. Günter Grass: Im Krebsgang ;58 1.3.4.1;2.4.1 Im Krebsgang als perspektivische Novelle in Bezug auf die Täter-Opfer-Problematik ;58 1.3.4.2;2.4.2 Der Krebsgang als Metapher für Grass' Erinnerungsmodell ;60 1.3.4.3;2.4.3 Die Erinnerung der ersten Generation Täter als Opfer? ;63 1.3.4.4;2.4.4 Die Erinnerung der zweiten und der dritten Generation polare Reaktionen auf die Abgrenzung von der Zeitzeugen-Generation ;65 1.3.4.5;2.4.5 Die Bedeutung der Neuen Medien für die Erinnerungskultur ;66 1.3.4.6;2.4.6 Der Schriftsteller als Verantwortungsträger im Diskurs der Erinnerung ;68 1.3.4.7;2.4.7 Grass' Novelle als Mahnung vor der Erblast unbewältigter Vergangenheit ;69 1.4;3 Die Achtundsechziger-Generation ;70 1.4.1;3.1 Uwe Timm Am Beispiel meines Bruders ;72 1.4.1.1;3.1.1 Timm im Lichte des Achtundsechziger-Zeitgeistes ;72 1.4.1.2;3.1.2 Die Exemplifizierung der kritisch-analytischen Auseinandersetzung mit den fami-liären Biographien im Achtundsechziger-Zeitgeist in Timms Am Beispiel meines Bru-ders ;72 1.4.1.3;3.1.3 Die Achtundsechziger-Generation als Erben einer bruchstückhaften Erinnerungs-tradierung ;73 1.4.1.4;3.1.4 Kommunikatives und kulturelles Gedächtnis in Am Beispiel meines Bruders ;77 1.4.1.5;3.1.5 Am Beispiel meines Bruders zwischen objektiver Wahrheitssuche und Schuldrela-tivierung ;78 1.4.2;3.2 Bernhard Schlink - Der Vorleser ;79 1.4.2.1;3.2.1 Schlinks Der Vorleser zwischen Erinnerungspoetik und öffentlich-politischem Erinnerungsdiskurs ;79 1.4.2.2;3.2.2 Hanna Schmitz Opfer oder Täterin? ;81 1.4.2.3;3.2.3 Der Vorleser und Ein springender Brunnen die literarische Forderung nach ei-nem Umdenken im Erinnerungsdiskurs ;86 1.4.2.4;3.2.4 Bernhard Schlink als Kritiker der Achtundsechziger-Ideologie ;88 1.5;4 Die Enkelgeneration ;91 1.5.1;4.1 Die Zukunft der Erinnerung ;94 1.5.2;4.2 Die Rolle der Literatur im zukünftigen Erinnerungsdiskurs ;98 1.6;5 Schlussbetrachtung ;102 1.7;6. Literaturverzeichnis ;105 1.7.1;6.1. Quellen ;105 1.7.2;6.2. Sekundärliteratur ;106 1.
8;Autorenprofil ;116
2.4. Günter Grass: Im Krebsgang ;58 1.3.4.1;2.4.1 Im Krebsgang als perspektivische Novelle in Bezug auf die Täter-Opfer-Problematik ;58 1.3.4.2;2.4.2 Der Krebsgang als Metapher für Grass' Erinnerungsmodell ;60 1.3.4.3;2.4.3 Die Erinnerung der ersten Generation Täter als Opfer? ;63 1.3.4.4;2.4.4 Die Erinnerung der zweiten und der dritten Generation polare Reaktionen auf die Abgrenzung von der Zeitzeugen-Generation ;65 1.3.4.5;2.4.5 Die Bedeutung der Neuen Medien für die Erinnerungskultur ;66 1.3.4.6;2.4.6 Der Schriftsteller als Verantwortungsträger im Diskurs der Erinnerung ;68 1.3.4.7;2.4.7 Grass' Novelle als Mahnung vor der Erblast unbewältigter Vergangenheit ;69 1.4;3 Die Achtundsechziger-Generation ;70 1.4.1;3.1 Uwe Timm Am Beispiel meines Bruders ;72 1.4.1.1;3.1.1 Timm im Lichte des Achtundsechziger-Zeitgeistes ;72 1.4.1.2;3.1.2 Die Exemplifizierung der kritisch-analytischen Auseinandersetzung mit den fami-liären Biographien im Achtundsechziger-Zeitgeist in Timms Am Beispiel meines Bru-ders ;72 1.4.1.3;3.1.3 Die Achtundsechziger-Generation als Erben einer bruchstückhaften Erinnerungs-tradierung ;73 1.4.1.4;3.1.4 Kommunikatives und kulturelles Gedächtnis in Am Beispiel meines Bruders ;77 1.4.1.5;3.1.5 Am Beispiel meines Bruders zwischen objektiver Wahrheitssuche und Schuldrela-tivierung ;78 1.4.2;3.2 Bernhard Schlink - Der Vorleser ;79 1.4.2.1;3.2.1 Schlinks Der Vorleser zwischen Erinnerungspoetik und öffentlich-politischem Erinnerungsdiskurs ;79 1.4.2.2;3.2.2 Hanna Schmitz Opfer oder Täterin? ;81 1.4.2.3;3.2.3 Der Vorleser und Ein springender Brunnen die literarische Forderung nach ei-nem Umdenken im Erinnerungsdiskurs ;86 1.4.2.4;3.2.4 Bernhard Schlink als Kritiker der Achtundsechziger-Ideologie ;88 1.5;4 Die Enkelgeneration ;91 1.5.1;4.1 Die Zukunft der Erinnerung ;94 1.5.2;4.2 Die Rolle der Literatur im zukünftigen Erinnerungsdiskurs ;98 1.6;5 Schlussbetrachtung ;102 1.7;6. Literaturverzeichnis ;105 1.7.1;6.1. Quellen ;105 1.7.2;6.2. Sekundärliteratur ;106 1.
8;Autorenprofil ;116
Produktdetails
Erscheinungsdatum
01. Juli 2012
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
117
Autor/Autorin
Anne Molitor
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
ohne Kopierschutz
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
PDF
ISBN
9783842821507
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Erinnernde Literatur - Die Verarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit in der deutschen Nachkriegsliteratur" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.







