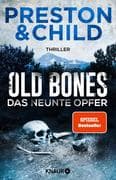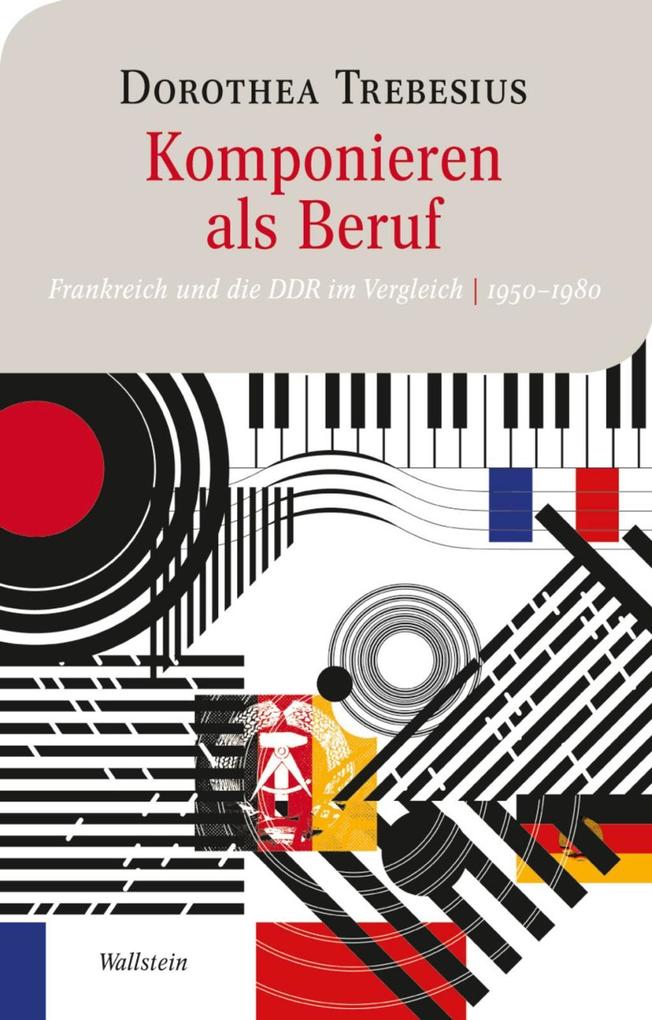In Frankreich und in der DDR gewannen Musik und Kunst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen neuen Stellenwert in Politik und Gesellschaft. Davon profitierten auch künstlerische Berufe wie der des Komponisten. Die Berufsausübung, die Ausbildung und die Berufsverbände der Komponisten wurden dabei ebenso grundlegend umgestaltet wie die staatliche Unterstützung. Dorothea Trebesius analysiert diesen Wandel in den beiden Ländern aus der Perspektive der Professionalisierung des künstlerischen Feldes in zentralistischen Staaten. Sie untersucht die Strategien und Stellung der Komponisten, ihre Selbstbilder und Wahrnehmung, ihre Ausbildung und Funktion in der Gesellschaft. Sie fragt insbesondere, welche Rolle der Staat und dessen demokratische bzw. staatssozialistische Kulturpolitik bei der Konstruktion und Praxis des Komponistenberufes spielten. Sie arbeitet sowohl systembedingte und nationale Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Ländern heraus, die sich durch geteilte Traditionen und Erfahrungen sowie durch europäische Austauschprozesse erklären lassen.
Inhaltsverzeichnis
1;Umschlag;1 2;Titel;4 3;Impressum;5 4;Inhalt;6 5;Einleitung. Komponieren als Beruf in Frankreich und der DDR;8 5.1;Komponisten und Musiker in der historischen, soziologischen und musikwissenschaftlichen Forschung;12 5.2;Die Professionalisierung des Komponistenberufes;20 5.3;Der Komponistenberuf in Frankreich und der DDR im Vergleich;24 5.4;Zeitliche Eingrenzung, Quellen und Aufbau der Arbeit;29 6;Teil I: Komponisten, Staat und Kunstlerpolitik in Frankreich und der DDR;34 6.1;1. Musikpolitik als Kunstlerpolitik. .Akteure, Ziele und Felder in Frankreich und der DDR;36 6.1.1;1.1 La guerre des musiciens. Der Krieg der Musiker und die Kunstlerpolitik in Frankreich;39 6.1.2;1.2 Die Kunstlerpolitik in der DDR;61 6.1.3;1.3 Leitvorstellungen und Modelle staatlicher Kunstlerpolitik in Frankreich und der DDR;85 6.2;2. Komponist, Staat und Markt. .Das Auftragswesen als Institution der Kunstlerpolitik;92 6.2.1;2.1 Almosen oder Auszeichnung? Der Wandel des staatlichen Auftragswesens in Frankreich;94 6.2.2;2.2 Vom staatlichen zum gesellschaftlichen Auftragswesen in der DDR;111 6.2.3;2.3 Von der Kunstförderung zur Regulierung des musikalischen Feldes;128 7;Teil II: Musikalisches Wissen und die kompositorische Ausbildung;134 7.1;3. Die höhere musikalische Bildung und .das Kompositionsstudium in Frankreich und der DDR;136 7.1.1;3.1 Ziele und Organisation der höheren musikalischen Bildung in Frankreich;140 7.1.2;3.2 Das Kompositionsstudium am Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris;155 7.1.3;3.3 Wir brauchen mehr Tutti-Komponisten. Musikhochschulen in der DDR;173 7.1.4;3.4 Zwischen Berufsbildung und Disziplin. Das Kompositionsstudium an den Musikhochschulen der DDR;193 7.1.5;3.5 Die Akademisierung professionellen Wissens in Frankreich und der DDR;207 7.2;4. Wettbewerbe, Preise und kunstlerische Leistung;214 7.2.1;4.1 Der Prix de Rome de composition musicale;217 7.2.2;4.2 Die Meisterschulerausbildung an der Akademie der Kunste der DDR;228 7.2.3;4.3 Kompositorische Leistun
g im musikalischen Feld;244 8;Teil III: Institutionalisierung und Organisation des Komponistenberufes;248 8.1;5. Komponisten in Frankreich und der DDR. .Berufsbedingungen und Karrieremuster;250 8.1.1;5.1 Soziale Herkunft und geographische Mobilität;250 8.1.2;5.2 Berufsbild und Karriereverläufe;260 8.2;6. Berufsorganisationen in Frankreich und der DDR;264 8.2.1;6.1 Verwertung von Rechten, kunstlerische Qualität und gesellschaftliche Anerkennung. Berufsorganisationen in Frankreich;267 8.2.2;6.2 Regeln und Bedingungen der Beruflichkeit. Der Verband der Komponisten und Musikwissenschaftler der DDR;280 8.2.3;6.3 Ziele und Funktionen von Berufsorganisationen in Frankreich und der DDR;297 9;Schluss. Die Professionalisierung von Komponisten im Kultur- und Wohlfahrtsstaat;303 10;Anhang;323 11;Abbildungs- und Tabellenverzeichnis;338 12;Abkurzungen;340 13;Quellen und Literatur;342 14;Dank;363 15;Register;364