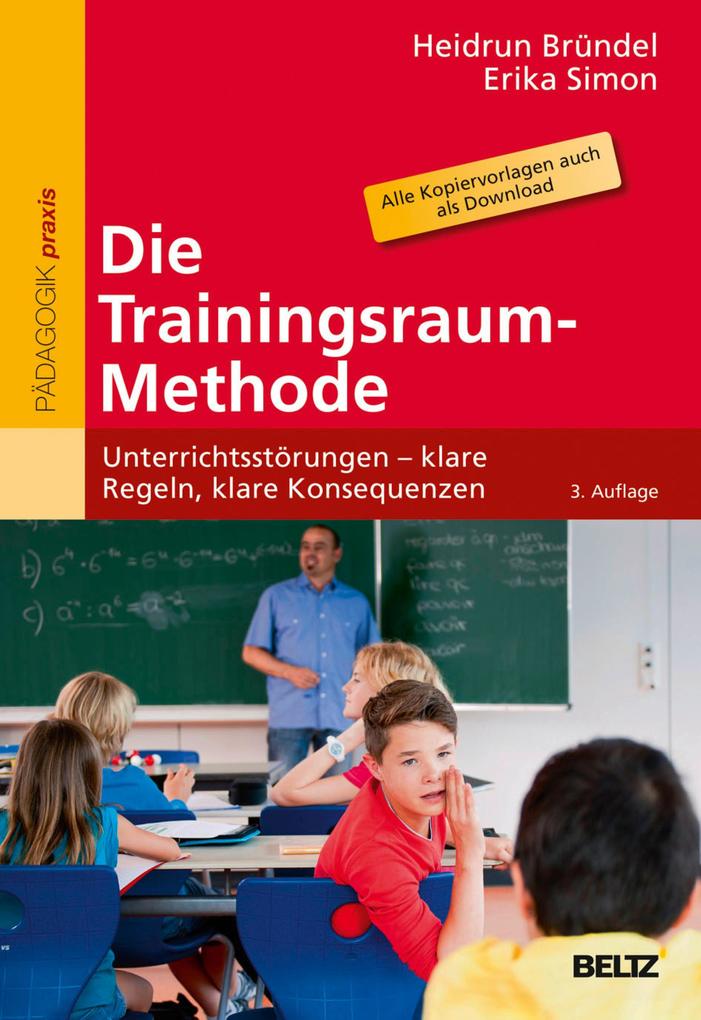Störungsfrei unterrichten und Schüler/innen zu eigenverantwortlichem Handeln motivieren: Beides leistet die Trainingsraum-Methode. Sie gibt klare Regeln und Konsequenzen vor, wodurch die Schüler/innen Orientierung erhalten und ein respektvolles Miteinander im Klassenraum ermöglicht wird.
Das erfolgreiche Buch wurde um das Kapitel »Qualitätsanforderung und Qualitätssicherung« ergänzt. Es zeigt auf, wie Fehlentwicklungen vermieden werden können. So führt die Trainingsraum-Methode zur Einstellungs- und Verhaltensänderung bei Schüler/innen und wird nicht als Sanktionsinstrument missverstanden.
Die Trainingsraum-Methode wird in allen Schulformen erfolgreich eingesetzt, sie ist konkret und praktikabel: Die einheitliche Reaktion auf Unterrichtsstörungen und der aktive Umgang mit den Störenfrieden motivieren zur Verhaltensänderung und zum respektvollen Umgang miteinander.
Auch der »Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen« hat das Trainingsraumkonzept von Bründel/Simon geprüft und ihm im November 2010 die »Qualitätsstufe 1 für ein nach wissenschaftlichen und didaktischen Gesichtspunkten Erfolg versprechendes Präventionsprogramm« bescheinigt (Sektion Politische Psychologie und Expertenbeirat Prävention von Gewalt, Rechtsextremismus und interkulturellen Konflikten).
Inhaltsverzeichnis
1;Inhaltsverzeichnis;6 2;Vorwort zur 3. Auflage;10 3;Vorwort;14 4;Einleitung: Unterrichtsstörungen ein leidiges Thema;16 5;1. Wie entsteht Verhalten?;21 5.1;Ein bisschen Theorie muss sein;21 5.2;Erklärungsmodelle zur Entstehung und Veränderung von Verhalten;22 6;2. Wenn Schülerinnen und Schüler stören . . .;25 6.1;Individualistische Handlungstheorien;27 6.2;Normfolgende Handlungstheorien;27 6.3;Systemtheoretische Handlungstheorien;32 6.4;Auf einen Blick: Wie wird Verhalten hervorgebracht?;33 6.5;Peter möchte Marias Aufmerksamkeit;33 6.6;Gewinn und Nutzen;38 6.7;Wann sind Schülerinnen und Schüler bereit, ihr Störverhalten aufzugeben?;38 7;3. Ein anderes Verständnis von Störungen;40 7.1;Abkehr von Interpretation und Abwertung;40 7.2;Hinwendung zu einer offenen Ursachenannahme;41 7.3;Verhalten wahrnehmen, reflektieren und ändern;43 8;4. Eigenverantwortlich denken und handeln;44 8.1;Die Grundidee von Eigenverantwortung;44 8.2;Strategien zur Vermeidung von Verantwortung;45 8.3;Die Verantwortung des Schülers;48 8.4;Die Verantwortung des Lehrers;48 8.5;Rechte und Pflichten von Lehrern und Schülern;50 9;5. Regeln unterstützen das eigenverantwortliche Handeln;51 9.1;Regeln bieten Orientierung;51 9.2;Vereinbarungen und Konsequenzen;51 9.3;Regeln unterstützen das eigenverantwortliche Denken und Handeln;53 10;6. Was machst du?;54 10.1;Der Frageprozess im Unterricht;54 10.2;Die Schülerinnen und Schüler können sich entscheiden;56 10.3;Skeptische Fragen von Lehrerinnen und Lehrern und mögliche Antworten darauf;58 11;7. Was geschieht im Trainingsraum?;61 11.1;Der Trainingsraum als Herzstück des Programms;61 11.2;Der Ablauf im Überblick;64 11.3;Zuweisung an den Trainingsraum;65 11.4;Die Suche nach der kontrollierten Variablen;65 11.5;Drei Trainingsraumgespräche;66 11.6;Die Suche nach dem zukünftigen Verhalten;70 11.7;Trainingsraumgespräch: Britta;70 11.8;Die kooperative Gesprächsführung im Trainingsraum;74 11.9;Phasen des Gesprächs im Trainingsraum;79 11.10;Leitlinien für die Traini
ngsraumlehrerinnen und -lehrer;80 11.11;Wie werden Pläne erstellt?;80 11.12;Wie erstelle ich einen Plan?;81 11.13;Unterrichtsstörungen und darauf bezogene Ideen für Pläne;82 11.14;Was geschieht mit den Plänen?;84 11.15;Wenn Schülerinnen und Schüler sich im Trainingsraum verweigern;87 11.16;Der Trainingsraum als Mediationsraum;88 12;8. Ist das Programm auch für Grundschulen geeignet?;93 12.1;Ein Trainingsraumgespräch in der Grundschule;94 12.2;Auch Grundschulkinder können Eigenverantwortung lernen;96 12.3;Der Trainingsraum wird in den Klassenraum verlegt;98 12.4;Visualisierung der Regeln und der Pläne;98 13;9. Elterngespräche;108 13.1;Gründe für das Elterngespräch;108 13.2;Das Interventionsteam;109 13.3;Ein Elterngespräch;111 14;10. Wie werden Eltern und Schüler informiert?;115 14.1;Die Eltern werden auf einem Elternabend informiert;115 14.2;Rede an die Eltern;115 14.3;Eine kleine Vorführung;119 14.4;Die Schülerinnen und Schüler werden im Unterricht informiert;121 14.5;Mit den Schülern Regeln vereinbaren;121 14.6;Der Frageprozess wird mit den Schülern durchgespielt;123 14.7;Ein gemeinsamer Gang in den Trainingsraum;124 15;11. Etwas Bürokratie ist notwendig;125 15.1;Das Zuweisungsformular;125 15.2;Das Formular Mein Plan;125 15.3;Das Tagesprotokoll;128 16;12. Aller Anfang ist schwer;130 16.1;Die kollegiumsinterne Konferenz;130 16.2;Arbeitsform Thema;131 16.3;Organisation;137 16.4;Schulung der Trainingsraumlehrerinnen und -lehrer;138 16.5;Die Bedeutung der Schulleitung;139 17;13. Kritische Einwände gegen das Programm;142 17.1;Der Argumente sind viele;142 17.2;Warum wirkt das Programm so polarisierend?;149 18;14. Der Erfolg gibt uns recht;152 18.1;Die Zufriedenheit von Lehrern und Schülern;152 18.2;Fazit;157 19;15. Qualitätsstandards es geht nicht ohne !;159 19.1;Professionelle Einführung in das Programm;161 19.2;Aktive Unterstützung des Programms durch die Schulleitung;162 19.3;Vorabinformation der Schülerund Elternschaft;162 19.4;Hohe Akzeptanz und einheitliche Anwendu
ng im Kollegium;163 19.5;Permanente Besetzung des Trainingsraums;163 19.6;Intensive Ausbildung der zukünftigen Trainingsraumlehrkräfte in Gesprächsführung;164 19.7;Stufenweise Einführung des Programms;164 19.8;Konsequente und konsistente Einhaltung der Spielregeln;165 19.9;Auf die Qualität der Pläne achten;166 19.10;Beachtung und Wertschätzung für die nicht störenden Schüler;166 19.11;Ein Appell an die Schulbehörden;166 19.12;Weitere Forderungen und Empfehlungen (Expertenrat 2010);167 20;Ausklang;170 21;Literaturverzeichnis;172