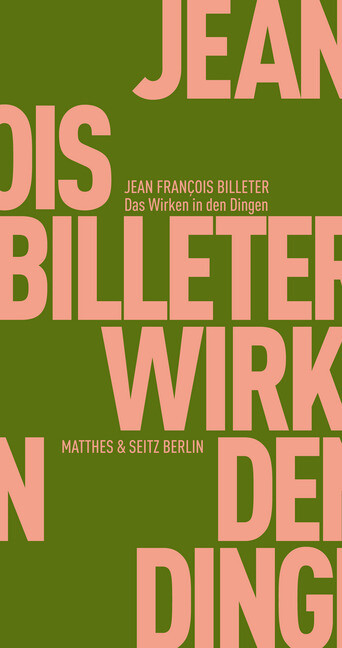
Zustellung: Di, 08.07. - Do, 10.07.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiDas in der Zeit der Streitenden Reiche entstandene Werk des chinesischen
Gelehrten Zhuangzi gilt als Grundlagentext des Daoismus,
wird aber üblicherweise als unergründlich für unseren westlichen
und modernen Blick erklärt. Jean François Billeter wendet sich gegen
diese verharmlosende Exotik und behauptet: Zhuangzis Schriften
sind verständlich und offenbaren den Meister als subversiven Philosophen
radikaler Autonomie. Mehr als das: Durch die Konfrontation
mit Denkern wie Wittgenstein, Kleist und Montaigne entsteht ein
mehr als zweitausend Jahre überspannendes intellektuelles Gespräch,
das auf die grundlegenden Fragen der neueren Philosophie zielt. So
macht Billeter nicht nur einen der schönsten Texte der chinesischen
Geistesgeschichte endlich zugänglich, sondern pointiert auch sein
Erschütterungspotenzial für unser heutiges Leben, denn: »Vielleicht
sind wir sogar die Leser, die Zhuangzi sich gewünscht hätte«.
Gelehrten Zhuangzi gilt als Grundlagentext des Daoismus,
wird aber üblicherweise als unergründlich für unseren westlichen
und modernen Blick erklärt. Jean François Billeter wendet sich gegen
diese verharmlosende Exotik und behauptet: Zhuangzis Schriften
sind verständlich und offenbaren den Meister als subversiven Philosophen
radikaler Autonomie. Mehr als das: Durch die Konfrontation
mit Denkern wie Wittgenstein, Kleist und Montaigne entsteht ein
mehr als zweitausend Jahre überspannendes intellektuelles Gespräch,
das auf die grundlegenden Fragen der neueren Philosophie zielt. So
macht Billeter nicht nur einen der schönsten Texte der chinesischen
Geistesgeschichte endlich zugänglich, sondern pointiert auch sein
Erschütterungspotenzial für unser heutiges Leben, denn: »Vielleicht
sind wir sogar die Leser, die Zhuangzi sich gewünscht hätte«.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
23. Februar 2015
Sprache
deutsch
Auflage
2. Auflage
Seitenanzahl
156
Reihe
Fröhliche Wissenschaft
Autor/Autorin
Jean François Billeter, Jean Fr. Billeter
Übersetzung
Thomas Fritz
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
französisch
Produktart
kartoniert
Gewicht
142 g
Größe (L/B/H)
180/98/15 mm
ISBN
9783882213867
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Sein Verständnis des Zhuangzi bezieht [Billeter] ausschliesslich aus dem Text. Darum betont er eingangs auch seine Lesart, nämlich genau und sicher den Text zu erfassen, sie die einzig richtige Lesart. Sein Ansatz ist es, den Text zu entmystifizieren. So spricht Billeter auch nicht von Tao oder Weg, denn das würde dem Werk wieder einen chinesischen Stempel aufdrücken, er übersetzt dao oder tao meist als das titelgebende Wirken in den Dingen. Seine Vorlesungen zum Zhuangzi, in denen er zahlreiche Beispiele aus der westlichen Philosophie und Literatur, von Wittgenstein, Spinoza, Montaigne bis Kleist, zitiert, unterstreichen immer wieder eine räumliche und zeitliche Nähe, und das, obwohl Zhuangzi bereits um 350 v. Ch. Gelebt und gewirkt hat. [ ] Billeter will Zhuangzi verstehen und nicht eine uns fremde Denkungsart offenlegen. Zhuangzi erzählt von Erfahrungen, schreibt Gleichnisse, oft in dialogischer Form. Billeter greift Beispiele zum Lernprozess, dem Ablauf von Handlungen sowie zur Autonomie und Freiheit des Individuums heraus. [ ] Zhuangzi [] ist ein Meister im Beschreiben [] alltäglicher Erfahrungen. Darauf und was sie mit uns machen, lenkt Billeter den Blick. Immer wieder betont Billeter den Witz und den Sinn für die Dramaturgie des Zhuangzi, als wolle er auch hier sagen: Nur keine Angst, das chinesische Denken ist nicht so fremd, wie mancher denken mag. In sehr handlichem Format kann das Buch überall gelesen werden und verschafft uns einen angenehmen und anregenden Rückzug aus dem reglementierten Alltag. « - Peggy Kames, Ruizhong, 2/2015 Peggy Kames, Ruizhong
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Das Wirken in den Dingen" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.







