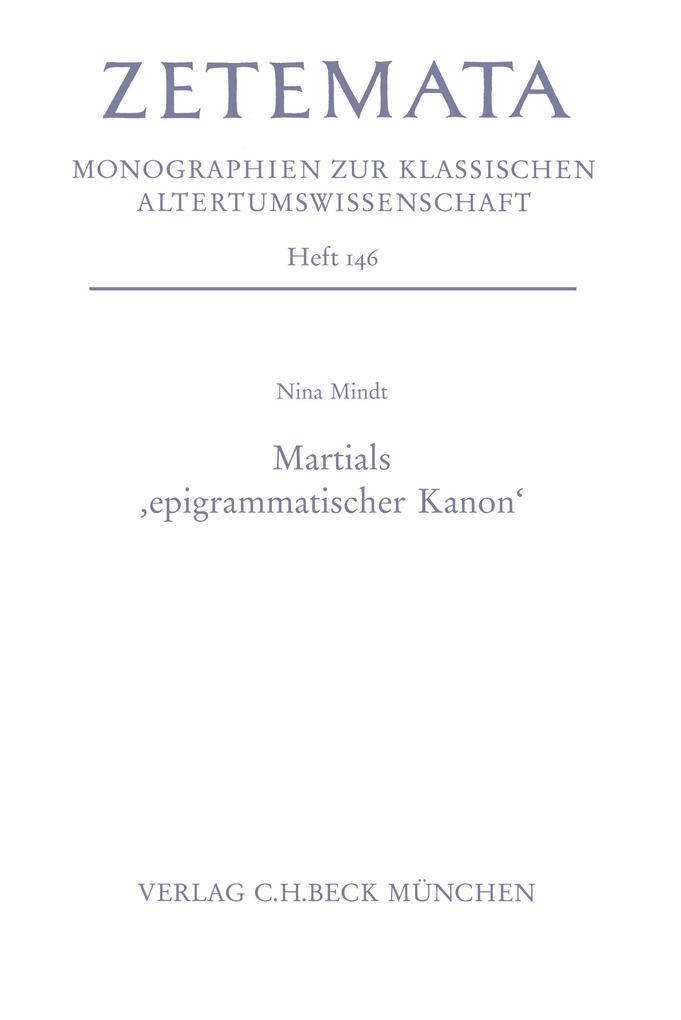Martial versteht es, in seine Epigramme zahlreiche Autoren und deren Werke funktional einzubinden, sei es durch direkten Verweis oder intertextuelle Verfahren. Es sind nicht nur Epigrammatiker, sondern Autoren aus fast dem gesamten antiken Gattungsspektrum, sowohl der Vergangenheit als auch der Gegenwart. So entsteht Martials , epigrammatischer Kanon', mit dessen Hilfe Martial das eigene literarische Genre aufwertet und nicht zuletzt an der eigenen Selbstkanonisierung arbeitet.
Inhaltsverzeichnis
1;Cover;1 2;Titel;4 3;Impressum;5 4;Inhalt;6 5;Einleitung: Martials Epigrammatischer Kanon. Begriffe, Methoden und Fragestellungen;10 6;Ouvertüre: Der Sog. Bücherzyklus (XIV 183-196);26 7;Erstes Kapitel: Die Klassiker der Römischen Literatur Par Excellence. Die Präsenz Ciceros und Vergils in Martials Epigrammen;32 7.1;I. Cicero;32 7.1.1;1. Die Größe des ciceronischen Werks (XIV 188);33 7.1.2;Exkurs: Livius und Sallust;34 7.1.3;2. Cicero als Teil der politischen Geschichte Roms (III 66; V 69; IX 70);36 7.1.4;3. Cicero als Dichter (II 89);45 7.1.5;4. Cicero als Anwalt par excellence und Klassiker der römischen Prosa;53 7.2;II. Vergil;71 7.2.1;1. Die Stellung Vergils innerhalb der lateinischen Literatur bei Martial;73 7.2.2;2. Das Werk Vergils in den Epigrammen Martials;79 7.2.3;Exkurs: Frontin;101 7.2.4;3. Die Vita Vergils: Vergil und Mäzenatentum;109 8;Zweites Kapitel: Die Werke Catulls und Ovids Als Omnipräsente Intertexte;132 8.1;I. Konstruktion Catulls als Epigrammatiker?;135 8.1.1;1. Catull als Verfasser von Kleindichtung und andere epigrammatische Vorläufer;140 8.1.2;2. Catulls kurze Gedichte bei Martial (Cat. 1-60 und 69-116);149 8.1.3;3. Catulls Großdichtung (Cat. 61-68);159 8.2;II. Die Vita Ovids als Ausgangspunkt epigrammatischer Applikation;162 8.2.1;Exkurs: Corpus Priapeorum;167 9;Drittes Kapitel: Der Versteckte Kanon;176 9.1;I. Den wahren Einfluss versteckend: Martials Umgang mit Horaz;176 9.1.1;1. Die explizite Präsenz des Horatius lyricus;176 9.1.2;Exkurs: Petron;182 9.1.3;2. Der versteckte Horaz der Episteln, Epoden und Satiren: Horaz als Sprachrohr des Dichterdaseins;183 9.1.4;Exkurs zur Satire: Juvenal und Persius bei Martial;187 9.2;II. Die Senecae;191 9.2.1;1. Seneca der Jüngere;191 9.2.2;2. Seneca der Ältere;196 10;Viertes Kapitel: Einst und Jetzt;198 10.1;I. Episch dichtende Patrone: Lukan und Silius Italicus;198 10.1.1;1. Lukan;199 10.1.2;2. Silius Italicus;205 10.2;II. (Selbst-) Darstellung eines aktuellen Literaturkreises;207 10.2.1;1. Literar
ische dinners;207 10.2.2;2. Flaccus;210 10.2.3;3. Stella;218 10.2.4;4. Canius Rufus;221 10.3;III. Weitere Namen des zeitgenössischen Literaturbetriebs;223 10.3.1;1. Inklusion;224 10.3.2;2. Exklusion;244 10.4;IV. Querelle des Anciens et des Modernes bei Martial;254 10.5;V. Zeitenvergleich;259 10.5.1;1. Literarhistorische exempla;259 10.5.2;Exkurs: Tibull;261 10.5.3;2. Die Rolle der Augusteer als Folie des aktuellen Literatursystems;264 11;Fünftes Kapitel: Strategien Zur Umwertung Der Klassischen Bibliothek;268 11.1;I. Lizenzen innerpoetischer Literaturgeschichte;268 11.1.1;1. Von dichterischer Freiheit bis zur manipulierten Literaturgeschichte;268 11.1.2;2. Phaedrus im epigrammatischen Kanon eine Besonderheit der antiken Literaturgeschichtsschreibung;269 11.1.3;3. Leerstelle im Kanon: Lehrdichtung bei Martial;271 11.2;II. Epigrammatische Transformationsmodi und -typen und ihre Effekte;273 11.3;III. Selbstkanonisierung: Martial und seine Leser;275 12;Bibliographie;288 12.1;1. Ausgaben, Kommentare und Übersetzungen zu Martial;288 12.2;2. Primärliteratur (z.T. kommentiert) und Kommentare zu anderen Autoren;288 12.3;2. Sekundärliteratur;289 13;Register;312 14;Zum Buch;320 15;Über die Autorin;320