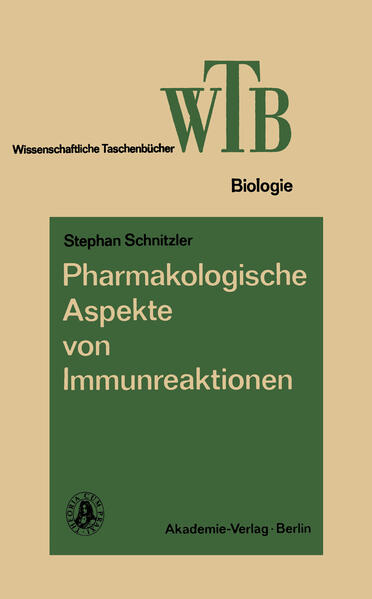
Zustellung: Fr, 16.05. - Mo, 19.05.
Versand in 2 Tagen
VersandkostenfreiDie Therapie anaphylaktischer Erkrankungen hat sich in den letzten Jahren wesentlich verandert. Dies geht auf Erfolge interdisziplinarer Arbeit von Immunologen und Pharmakologen zurUck. Ergebnisse der Grundlagen forschung konnten sehr schnell in die klinische Praxis iiberfiihrt werden. Das Grenzgebiet zwischen Immunologie und Pharma kologie heiI3t Immunopharmakologie. Es ist keine neue Disziplin. Vor dem ersten Weltkrieg bestand z. B. am pharmakologischen Institut der Berliner Universitat eine immunologische Arbeitsgruppe unter FRmDBERGER, dem Entdecker des Anaphylatoxins. Die Entdeckung wichtiger Studienobjekte der ImmunoPharmakologie wie die Mastzelle (EHRLICH 1878) und das Histamin (WINDAUS 1907) liegt ebenfalls lange zuriick. Eine klas sische immunopharmakologische Arbeitsmethode, der SCHULTZ-DALE-Test, wurde erstmals 1910 beschrieben. Die im folgenden Text diskutierten Befunde stammen allerdings iiberwiegend aus den vergangenen zehn Jahren. Immunopharmakologie befaI3t sich mit der Untersuchung physiologischer und pharma kologischer Ablaufe bei Immunreaktionen (z. B. Bildung, Abgabe und Reaktionen von Mediatoren wie Histamin, 5-Hydroxytryptamin, SRS-A, ECF-A, Anaphylatoxin, Kininen u. a.), mit der pharmakologischen Beeinflussung immuno Iogischer Reaktionen (z. B. Immunosuppression, Anti allergika), 8 Vorwort mit der Anwendung immunologischer Methoden bei pharmakologischen Fragestellungen (z. B. Radio immunoassay, Rezeptorlokalisation), mit der Untersuchung und Beeinflussung immuno logischer Reaktionen auf Applikation von Pharmaka. Die Abgrenzung von Immunologie und Pharmakologie ist flieBend, oft nicht realisierbar. Ein gutes Beispiel ist Histamin, das in beiden Disziplinen eine Rolle spielt.
Inhaltsverzeichnis
1. Die Immunantwort. - 2. Überempfindlichkeit vom Frühtyp. - 3. Antigene, Haptene und Antikörper gegen kleine Moleküle. - 3. 1. Antigene Voraussetzungen. - 3. 2. Allergene. - 3. 3. Hapten-Träger-Konjugate. - 3. 4. Antikörper gegen kleine Moleküle. - 4. Arzneimittelallergie. - 5. Rezeptoren und Biomembranen. - 5. 1. Rezeptor-Ligand-Wechselwirkungen. - 5. 2. Fluidität von Membranen. - 5. 3. Immunologische Rezeptortheorien und das Multivalenz-Konzept. - 6. Stimulus-Respons-Kopplung. - 6. 1. Signalweitergabe. - 6. 2. Zyklische Nukleotide, K+und Ca2+. - 6. 3. Mikrotubuli und Mikrofilamente. - 7. Antigen-Antikörper-Reaktion, Antigen-Antikörper-Komplexe. - 7. 1. Immunglobuline, Antigen-Antikörper-Reaktion. - 7. 2. Antigen-Antikörper-Komplexe. - 7. 3. Biologische Effekte von Immunkomplexen. - 8. Komplementaktivierung. - 9. Immunglobulin E. - 10. Mastzellen und Basophile. - 10. 1. Morphologie und Eigenschaften. - 10. 2. Basophile Granulozyten. - 10. 3. Funktion. - 10. 4. Nichtimmunologische Mediatorabgabe. - 10. 5. Mediatorabgabe durch C3a und C5a. . - 11. Anaphylaktische Mediatorfreisetzung. - 11. 1. IgE-Fc-Rezeptoren. - 11. 2. Mechanismus der Freisetzung. - 12. Pharmakologie der Mediatorfreisetzung. - 13. Mediatoren. - 13. 1. Definition. - 13. 2. Histamin. - 13. 3. 5-Hydroxytryptamin (5-HT). - 13. 4. Slow reacting substance of anaphylaxis (SRS-A). . - 13. 5. Eosinophil chemotactic factor of anaphylaxis (ECF-A). - 13. 6. Platelet activating factor (PAF). - 13. 7. Prostaglandine. - 13. 8. Kinine. - 13. 9. Makromolekulare Mediatoren. - 13. 10. Beziehungen humoraler Mediatorsysteme. - 14. Eosinophile. - 15. Antiallergika. - 15. 1. Therapiemöglichkeiten und Testmodelle. - 15. 2. Kompetition um den IgE-Fc-Rezeptor. - 15. 3. Beeinflussung der IgE-Allergen-Wechselwirkung. . - 15. 4. Hemmung der Mediatorabgabe. - 15. 5. Antagonisten der Mediatoren. - 16. Literatur. - Begriffserklärungen. - 17. Sachregister.
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
01. Januar 1979
Sprache
deutsch
Auflage
1979
Seitenanzahl
176
Reihe
Biologie
Autor/Autorin
Stephan Schnitzler
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Abbildungen
170 S. 4 Abb.
Gewicht
196 g
Größe (L/B/H)
203/127/10 mm
ISBN
9783528068578
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Pharmakologische Aspekte von Immunreaktionen" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









