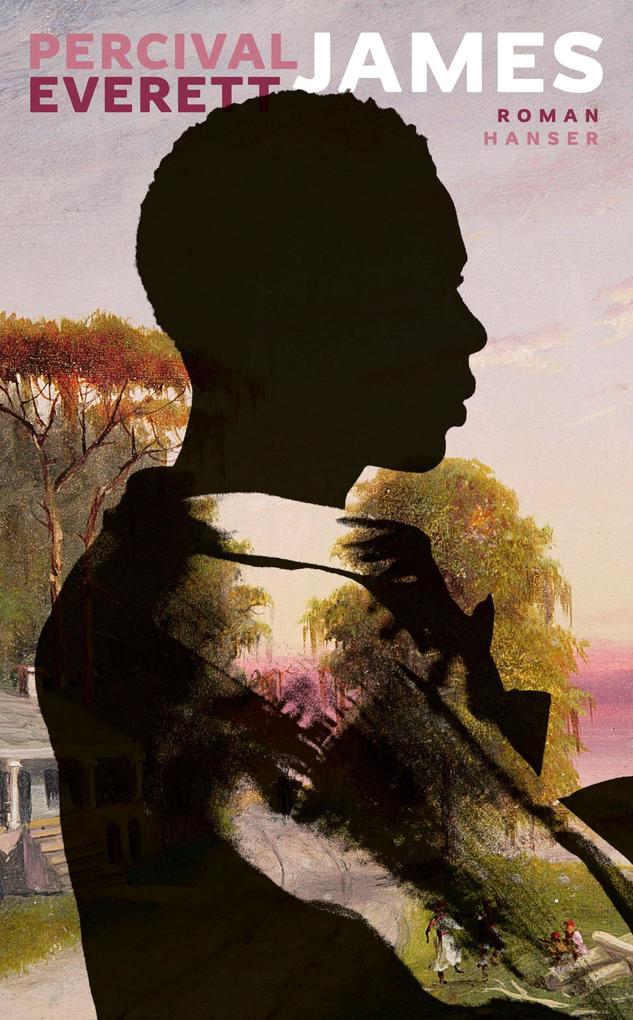James ist ein Buch, dass in sehr intelligenter und kreativer Weise in den Streit um Cancel Culture, Vogueness und politische Korrektness eingreift. Der amerikanische Romancier Percival Everett, ist Jahrgang 1956 und wurde schon etwas bekannt letztes Jahr mit seinem Roman Die Bäume.
Mit James wagt er sich an eine Überschreibung eines der ganz großen Werke der US-Amerikanischen Literatur, nämlich an den Roman von Mark Twain Die Abenteuer des Huckleberry Finn. Aber dieser Roman, heute gelesen, ist gar nicht unproblematisch.
Everett eröffnet uns einen neuen Blickwinkel auf die Geschichte, nämlich den, aus der Sicht des Sklaven Jim. Dieser Roman ist eine einzige große Sprachfantasie - Everett entwickelt diese Idee, dass dieses gesprochene Englisch nur eine Sprache ist für die dummen Weißen. Tatsächlich unterhalten sich die Schwarzen über Feinheiten zwischen proleptischer und tragischer Ironie oder ergehen sich in Träumereien in Gesprächen über Voltaire. Andererseits, das ist jetzt so verkopft, aber das ist auch ein handfester Actionroman, es hat mich ein bisschen erinnert an Quentin Tarantinos Django Unchained. Weil dieser James, der eben nicht Jim heißt sondern James, seine Familie beschreibt, die Abenteuer auf dem Mississippi erlebt, einen blutigen Rachefeldzug gegen den Richter, seinen Sklavenhalter unternimmt. Es ist eine Überschreibung eines Romans, aber es ist eben nicht ein Teil der Cancel Culture, sondern als Kontrafaktur eine eigene Geschichte gegen ein Werk, eigentlich die schönste Werbung für Mark Twain, die man sich vorstellen kann. Auch in der deutschen Übersetzung von Nikolaus Stingl, die mir hier überaus gelungen erscheint.
Sprache wird hier als ein strategisches Instrument verwendet, so wie im Tierreich manche Tiere ein bestimmtes Gefieder aufmachen, um zu täuschen. So sprechen die Schwarzen in diesem gebrochenen Englisch, um den Weißen vorzuführen, dass sie dumm und harmlos sind. Untereinander können sie aber im gestochensten Englisch sprechen, um nämlich ihre Gegenstrategie zu entwickeln. Es ist die Idee eines Empowerments, nämlich in dieser Geheimsprache eines vollausgebildeten Englisch, können die Schwarzen untereinander sich so verständigen, dass sie zu Gegenstrategien in der Lage sind. Das ist erzählerisch kein Gegenentwurf zu Mark Twain. Ich liebe, wie er aus Jim diesen James gemacht hat, nämlich ein voll souveränes Subjekt, dass die Handlung vorantreibt und mehr weiß als der junge Huck, für den er immer mitdenkt. Daraus ist gleichzeitig eingebettet, wie wir es von Mark Twain kennen, diese herrliche Mississippi Landschaft, die aber natürlich auch gleichzeitig eine Bedrohungslandschaft ist, nämlich als Schwarzer auf der Flucht, muss er natürlich in ganz anderer Weise um sein Leben bangen. Und die Natur dient gleichzeitig auch als Rückzugsort mit dem großen Mississippi als Grenze zum Norden, wo die Freiheit ihn erwartet.
Es gibt in der Literatur des 19. Jahrhunderts einen großen utopischen Moment, den Die Abenteuer des Huckleberry Finn markiert. Das sind eben die Szenen von Huck und Finn auf dem Floß. Wo plötzlich ein friedliches Zusammenleben von Schwarz und Weiß möglich scheint, wo eben in der Literatur zumindest, diese Rassenschranken überwunden werden. Das greift Percival Everett in diesem Roman sehr kunstvoll auf.
Es ist nicht nur eine Verbeugung vor, sondern auch eine Kritik an Mark Twain und auch an denjenigen, die sich für liberal und aufklärerisch halten und es eigentlich nicht sind. Das kann man z.B. daran sehen, dass Jim hier in diesem Roman James heißt, dass heißt er gibt sich selbst seinen Namen. Und in dem Roman geht es auch darum, dass James darüber nachdenkt, dass die Weißen eben immer das Bestreben haben zu Benennen und zu Beurteilen, selbst in ihrer Selbstkritik wollen sie die Fäden in der Hand behalten. Und das macht Mark Twain ja, er erzählt diese Geschichte. Ganz wesentlich ist in diesem Buch, dass es um das Aufschreiben der eigenen Geschichte geht. Da spielt ein Bleistift eine Rolle, den James bei seiner Flucht sich organisieren lässt von einem anderen versklavten Mann. Und dieser Mann wird dafür ausgepeitscht und getötet, ermordet. Und der Bleistift hat eine enorme Aufladung und Bedeutung. Und die eigene Geschichte aufzuschreiben hat eine enorme Bedeutung. Und es war kein Schwarzer, der Huckleberry Finn geschrieben hat, sondern es war ein Weißer: Mark Twain. Ich glaube, das ist auf sehr kluge Weise immer wieder in diesen Text eingewebt, dass es auch eine handfeste Kritik ist. Es taucht z.B auch immer wieder in der Figur von Huck der Satz auf: Daran hab ich gar nicht gedacht, dass ich dir Schaden könnte, mit dem was ich tue. Und diese Art von Gedankenlosigkeit, die ich von mir selbst auch kenne, das ist etwas was er hier kritisch erzählt. Kritisch in einem sehr produktiven, offenen, durchaus liebenden Verhältnis auch zu Mark Twain. Hier erfolgt kein Vorwurf, dass Mark Twain ein Weißer war. Damit James geschrieben werden konnte, musste es vorher die Mark Twainsche Geschichte geben. Es ist eine produktive Intertextualität.
Wir sollten auch das Motto bedenken, mit dem Mark Twain seine Geschichte beginnt: Wer in dieser Geschichte ein Motiv sucht wird des Landes verwiesen. Wer eine Handlung sucht, wird mit Geldstrafe belegt und wer eine Moral in dieser Geschichte zu finden versucht, wird erschossen. So beginnt Mark Twains Roman.
Ich wünschte mir heute diese Art von Gedankenfreiheit in der Literatur und nicht dieses Rechthaberische.
James ist sicherlich eine Kritik an den Weißen schlechthin, an Mark Twain, aber es ist Gottseidank eine produktive Fortschreibung.
Ich bin eine große Freundin von Literatur, die böse sein kann, die verletzend sein kann, die aufs Blut reitzt und nicht in einer Jugendbuchversion die jeweiligen Befindlichkeiten tätschelt. Ich möchte Bücher haben, die stechen, die verletzen und uns reizen. Das hat Mark Twain geschafft und Percival Everett führt es äußerst gelungen fort.