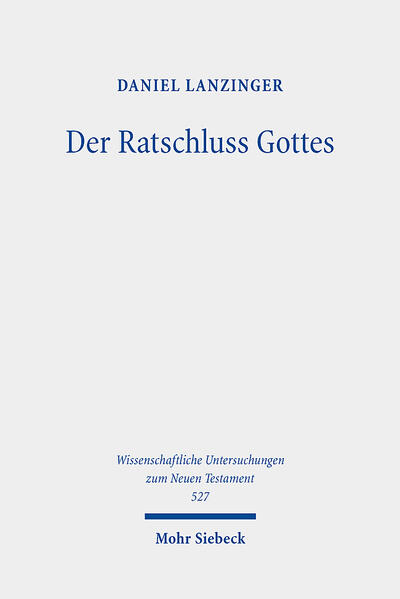Die Überzeugung, dass Gott einen Plan für die Menschen hat, zieht sich wie ein roter Faden durch das lukanische Doppelwerk. Daniel Lanzinger legt erstmals eine Studie vor, die dieses Motiv des göttlichen Ratschlusses unter erzähltechnischer Perspektive untersucht.
"Ich habe es nicht versäumt, euch den ganzen Ratschluss Gottes mitzuteilen" (Apg 20, 27), konstatiert Paulus in seiner Abschiedsrede vor den Ältesten von Ephesus. Vielen anderen Erzählfiguren im lukanischen Doppelwerk bleiben solche tiefen Einblicke allerdings verwehrt: Sie wissen nichts von einem göttlichen Ratschluss oder verstehen ihn nicht, werden aber gerade dadurch zu dessen Ausführungsorganen. Daniel Lanzinger zeigt auf, dass dieses Spiel mit diskrepanter Informiertheit ein konstitutives Element von Lukas' narrativer Theologie darstellt: Durch die erzähltechnische Erzeugung von Informations- und Verstehensvorsprüngen lädt der Evangelist seine Leserinnen und Leser zu einer kognitiven Mitarbeit an der Deutung der Geschehnisse ein. So entsteht im Prozess der Lektüre nach und nach ein Gesamtbild dessen, was den Ratschluss Gottes ausmacht, wie man ihn erkennt und wie er zur Umsetzung kommt.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. " Ein Zeichen, dem widersprochen wird" (Lk 2, 34): Gottes Ratschluss für Jesus
3. " . . . damit ihr nicht als Kämpfer gegen Gott vorgefunden werdet" (Apg 5, 39): Gottes Ratschluss im Diskurs zwischen den Aposteln und den Jerusalemer Autoritäten
4. " Aus Völkern ein Volk für seinen Namen" (Apg 15, 14): Gottes Ratschluss für Nichtjuden
5. " Vor dem Kaiser musst du stehen" (Apg 27, 24): Gottes Ratschluss für Paulus
6. Zusammenfassung der Ergebnisse: Eine narrative Theologie des Ratschlusses Gottes