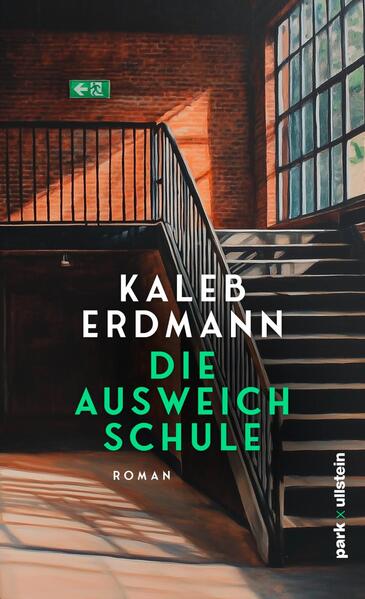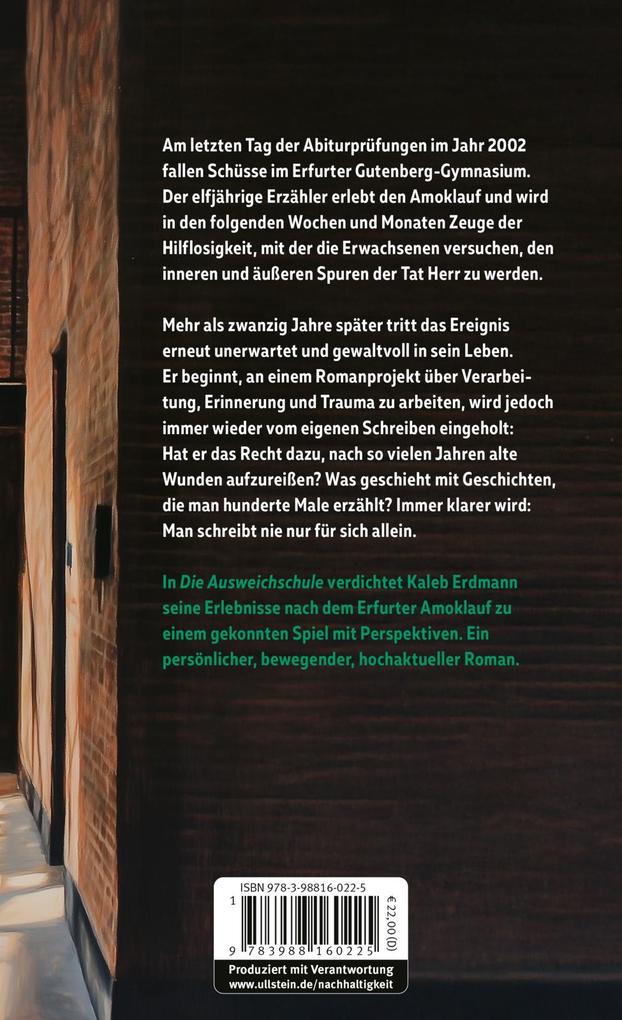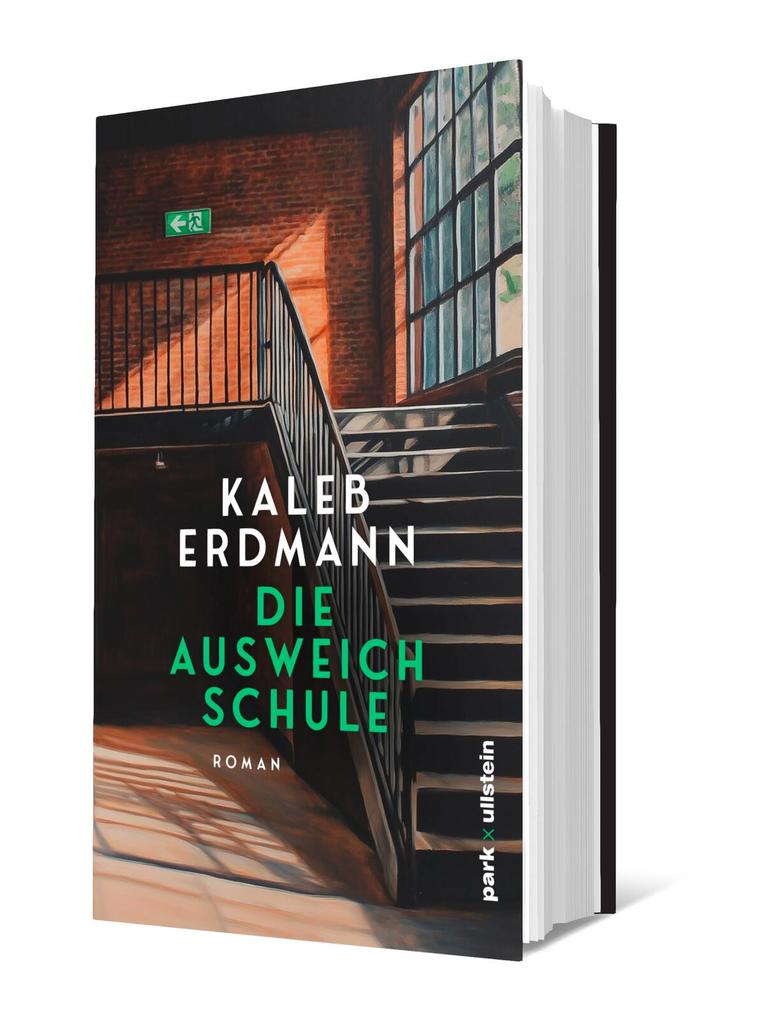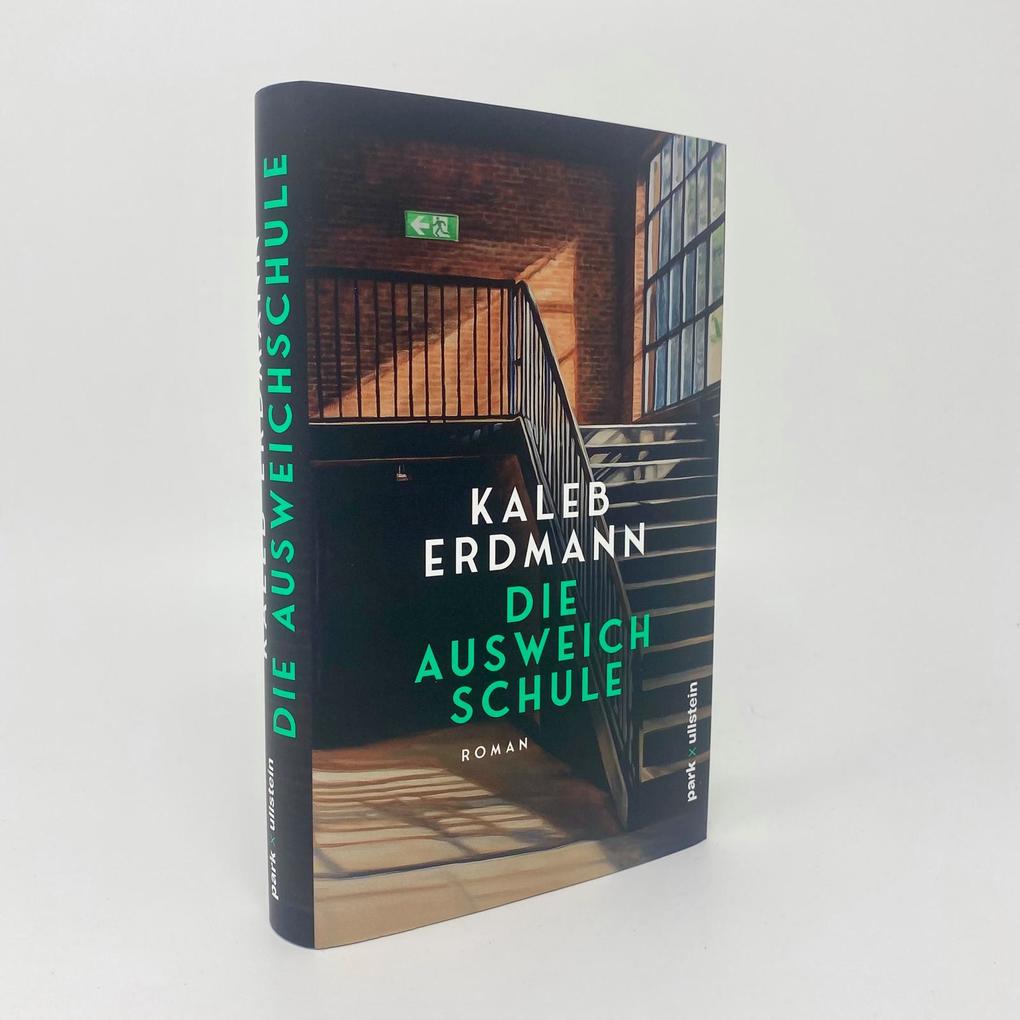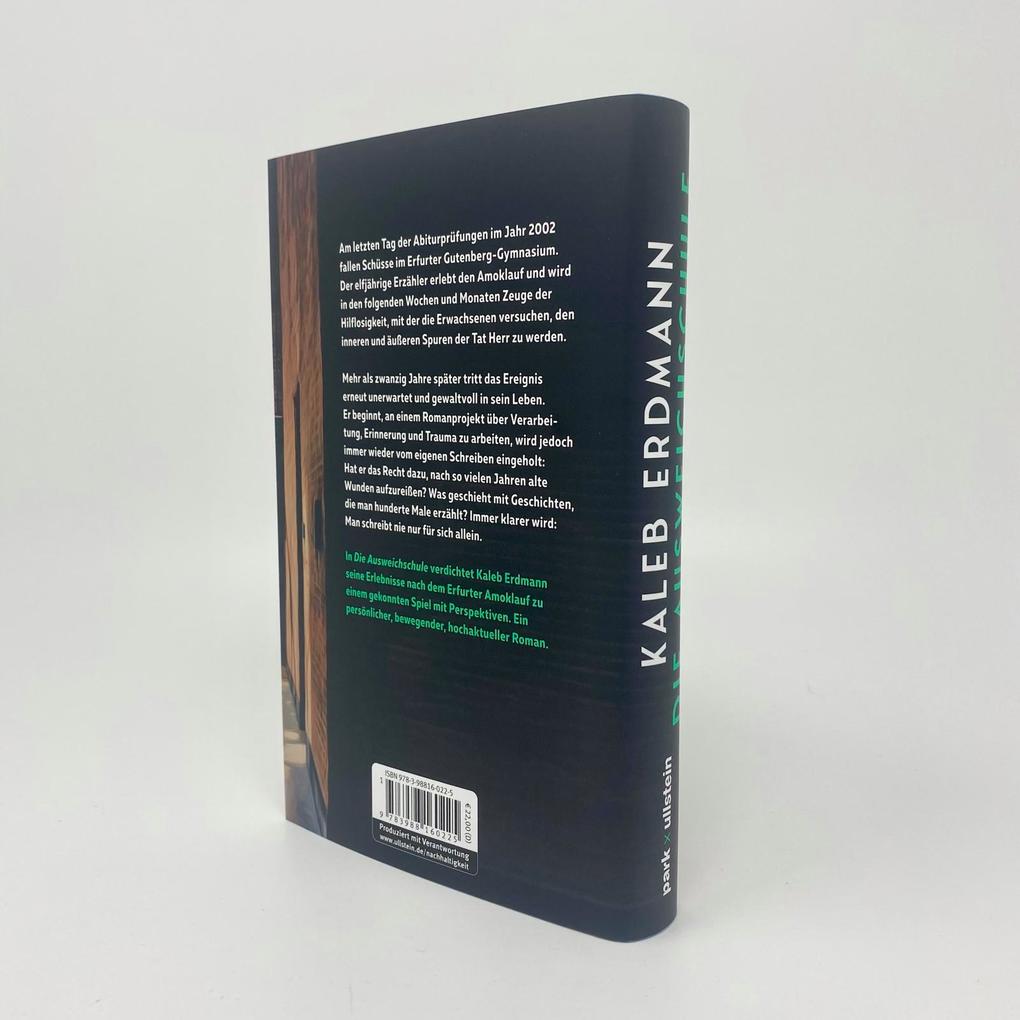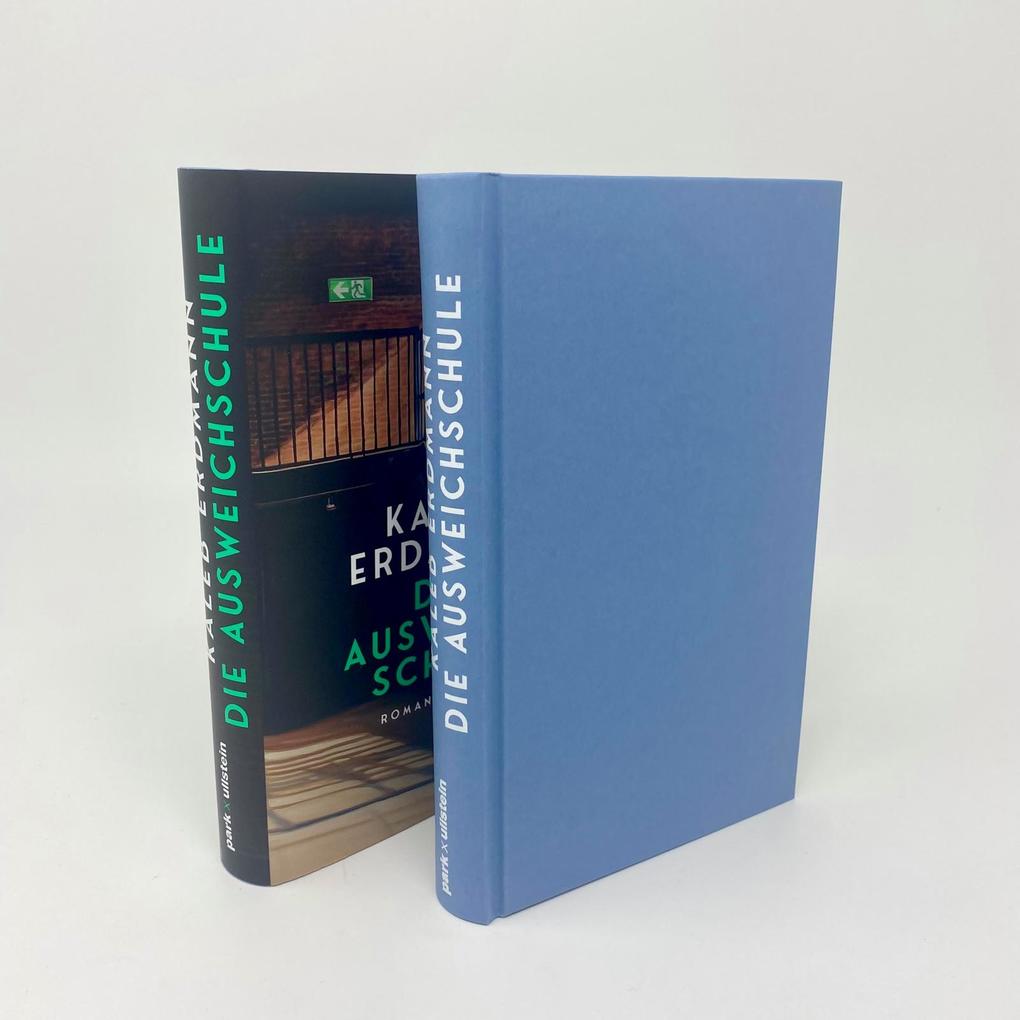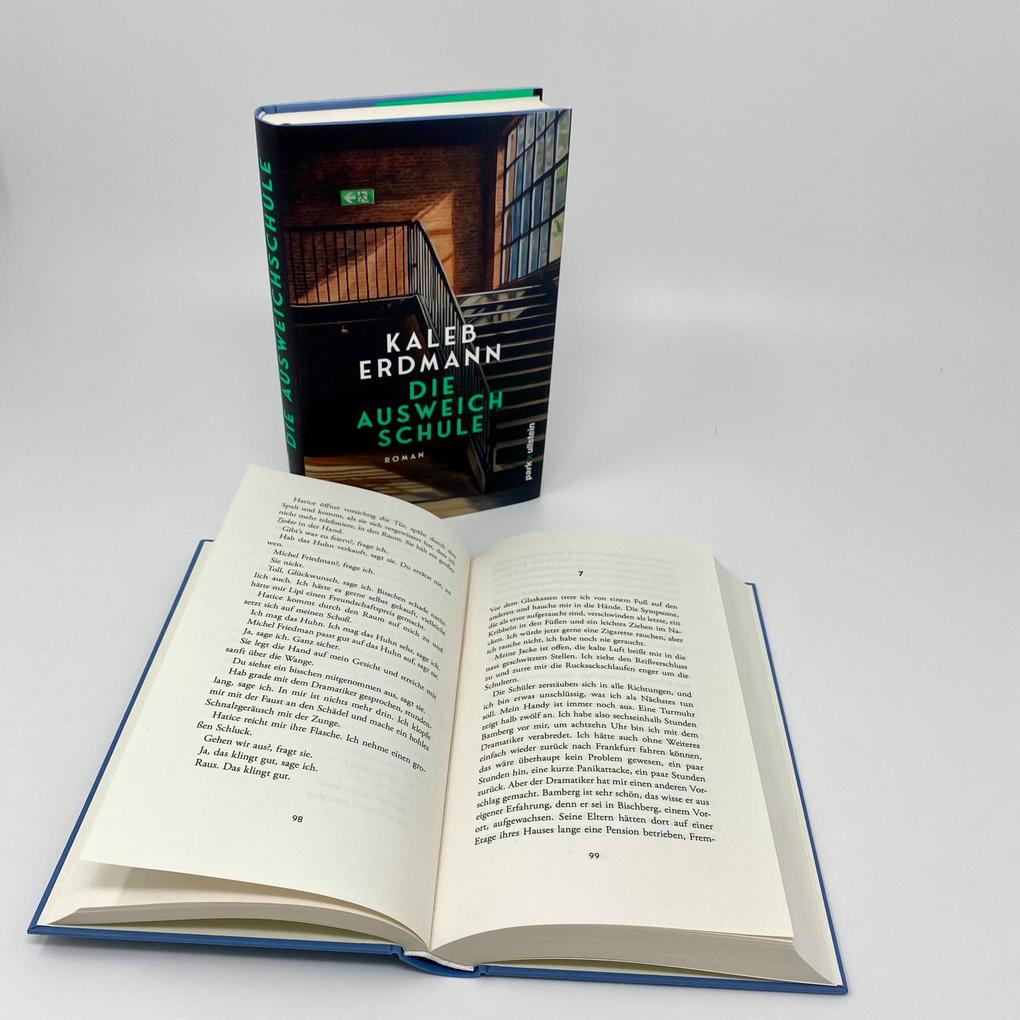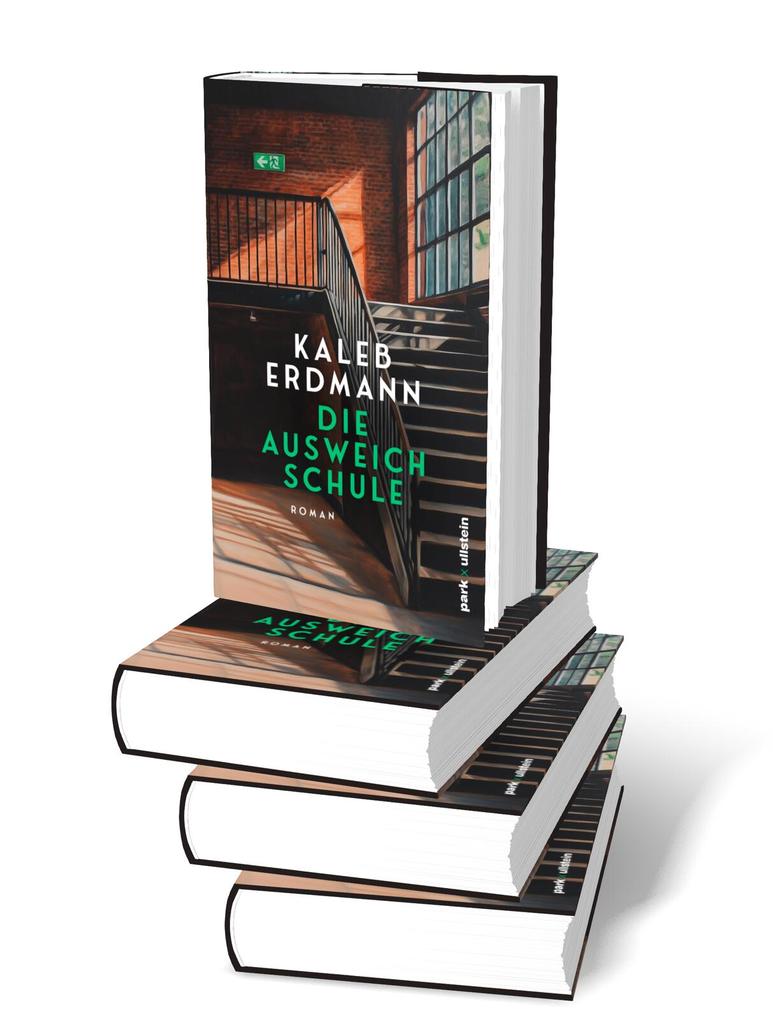Wohl jeder Schriftsteller kennt jenes seltsame, manchmal quälende Phänomen: Eine Geschichte, die tief im eigenen Inneren ruht womöglich eng verknüpft mit persönlichen Erfahrungen , bleibt lange ungesagt. Sie liegt verborgen, schweigt über Jahre hinweg, bis sie sich langsam, fast unmerklich, nach außen drängt. Irgendwann aber ist der Augenblick gekommen, in dem sie geschrieben werden muss. Selten jedoch ist der Kern einer solchen Geschichte so erschütternd wie bei Kaleb Erdmann, der in seinem jüngsten Werk Die Ausweichschule, das vom Verlag als Roman bezeichnet wird, auf den Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium zurückblickt. Als Elfjähriger war er damals Augenzeuge. Nun, mehr als zwei Jahrzehnte später, wagt er es, dieses Trauma in literarische Form zu bringen.
Zunächst könnte man annehmen, es handle sich um ein klassisches Projekt der Verarbeitung: Ein Autor versucht, ein einschneidendes Erlebnis durch Schreiben zu bewältigen. Doch gleich zu Beginn wird klar, dass Erdmann weit mehr beabsichtigt. Er findet eine ungewöhnliche Form, die Erlebnisse, ihre Folgen und die eigenen Reflexionen in einen Text zu verwandeln, der sich jeglicher einfachen Zuordnung entzieht. Das Buch wirkt wie eine Meta-Erzählung, beinahe wie ein Making-of zum eigenen Roman. Auslöser ist ein Dramaturg, der Erdmann für Recherchen zu einem Theaterstück zum Thema Amoklauf kontaktiert und damit alte Wunden aufreißt. Plötzlich sieht sich der Autor gezwungen, sich erneut mit einem Teil seiner Kindheit auseinanderzusetzen, der lange im Verborgenen schlummerte.
Erdmann war Teil des Geschehens, hat den maskierten Täter gesehen, die Panik gespürt und die Nachwirkungen Medienberichte, Therapien, Gespräche hautnah erlebt. Zugleich hat er jedoch keine unmittelbare Gewalt oder Tote mit eigenen Augen gesehen. Diese ambivalente Position wirft für ihn selbst die Frage auf, ob er überhaupt als glaubwürdiger Chronist gelten kann. Gerade diese Unschärfe führt jedoch zu einer literarischen Form, die sich von einem bloßen Augenzeugenbericht deutlich unterscheidet. Das Buch ist weder bloße Dokumentation noch reine Recherche, es ist kein Sachbuch, und es ist doch all das zugleich erweitert um den Blick des Suchenden, Zweifelnden, Reflektierenden.
So entsteht ein Text, der seine Kraft gerade aus dieser Vielschichtigkeit bezieht. Erdmann lädt seine Leser ein, Teil eines Denkprozesses zu werden. Statt eine klare Chronologie der Ereignisse zu liefern, öffnet er den Raum für Fragen, Unsicherheiten, Widersprüche. Erinnerungen erweisen sich nicht als unverrückbare Fakten, sondern als fragile Konstrukte, die sich im Nachhinein verschieben können. Erdmann beschreibt, wie er während des Schreibens immer wieder an den Punkt gelangt, vermeintlich gesicherte Erinnerungen in Frage zu stellen. Was lange als wahr galt, wirkt plötzlich brüchig. Neue Deutungen entstehen, frühere Ansichten erscheinen absurd oder zumindest fragwürdig.
Gerade diese Offenheit macht den Roman so eindrucksvoll. Ein hochbrisantes Thema ein Schulmassaker wird hier nicht nur von außen beschrieben, sondern von innen her ausgeleuchtet. Unterschiedliche Perspektiven werden miteinander verflochten, ohne dass am Ende ein endgültiges Resümee gezogen würde. Vielmehr zeigt sich: Der Weg der Auseinandersetzung ist selbst das Ziel. Erdmanns Versuch, mit dem eigenen Trauma ins Reine zu kommen, berührt mindestens so sehr wie seine Schilderungen des Tages selbst.
Eine besondere Stärke des Romans liegt darin, dass er auch die vermeintlichen Nebensächlichkeiten ernst nimmt. Kleine Irritationen, offene Fragen, unklare Erinnerungen alles, was in offiziellen Berichten oder Therapiegesprächen kaum Platz findet , werden hier zu zentralen Elementen. So erinnert er sich etwa an eine Schulsituation nach der Tat: die Frage, wer den Pinguin-Test korrigieren würde, den die Klasse kurz vor dem Amoklauf bei der später ermordeten Lehrerin geschrieben hatte. Für ein Kind mag dies banal erscheinen, doch in Wahrheit zeigt sich darin der tiefe Bruch, der Verlust von Normalität und die Unfähigkeit, das Geschehen in vertraute Abläufe einzuordnen. Gerade diese Details verleihen dem Text seine Authentizität und bringen dem Leser die menschliche Seite einer Katastrophe nahe, die sonst oft nur in nüchternen Zahlen oder reißerischen Schlagzeilen erscheint.
Besonders eindrucksvoll ist die Metapher der Ausweichschule: Jene Einrichtung, in die die Kinder nach der Tat gebracht wurden, um so etwas wie Normalität zurückzugewinnen, wird für Erdmann zum Sinnbild einer viel größeren Suche. Sie steht für den Versuch, einen Weg zurück ins Leben zu finden einen Weg, der oft zu früh als abgeschlossen galt, obwohl er es nie wirklich war.
Auch für Leser, die den Amoklauf nur aus den Nachrichten kennen oder vielleicht noch zu jung waren, um ihn bewusst mitzuerleben, öffnet das Buch neue Perspektiven. Man erfährt von inneren Bewegungen, die in keiner Berichterstattung, keiner Fachliteratur und kaum in Therapien vorkommen würden. Diese unscheinbaren Momente, die nie Schlagzeilen machen, sind es, die den Roman so einzigartig und eindringlich machen.
Die Ausweichschule ist damit weit mehr als eine autobiografische Spurensuche. Es ist ein literarisches Experiment, das die Grenzen zwischen Dokumentation, Fiktion und Reflexion verschwimmen lässt. In seiner schonungslosen Ehrlichkeit, in seiner Bereitschaft, auch Widersprüche auszuhalten, schafft Erdmann ein Werk, das lange nachhallt. Ein starkes, verstörendes und zugleich erhellendes Buch, das zeigt, wie Literatur selbst das Unaussprechliche in Sprache fassen kann.