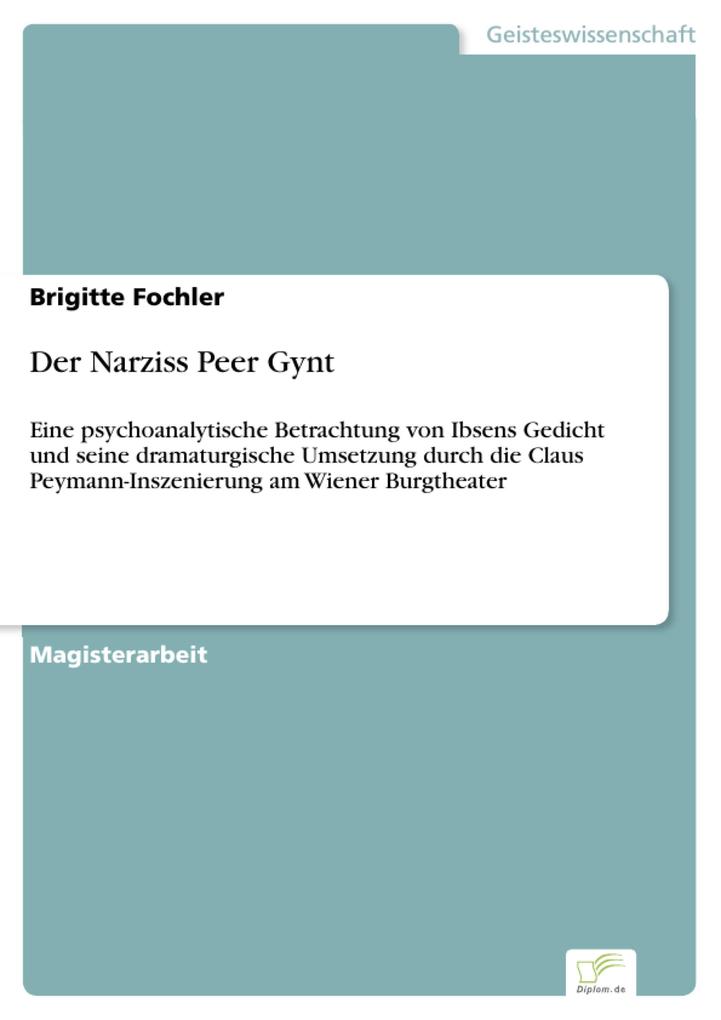
Sofort lieferbar (Download)
Inhaltsangabe:Einleitung:
Peer Gynt hat in Henrik Ibsens Schaffen einen besonderen Stellenwert. Das dramatische Gedicht wird in der Sekundärliteratur immer wieder als Übergangswerk bezeichnet. Die Dramaturgie ist nur schwer einzuordnen. Es gibt vergleichsweise sehr wenig Sekundärliteratur, vor allem Sekundärliteratur neueren Datums ist kaum zu finden. Dies ist erstaunlich, da es sich bei Peer Gynt um ein Schlüsselwerk handelt, weil es als Vorläufer für das moderne Theater gesehen wird. Es ist, wie Ruprecht Volz schreibt, weit seiner Zeit voraus und nimmt Elemente des Symbolismus, des Expressionismus und des absurden Theaters vorweg.
Doch auch in Ibsens Schaffen ist Peer Gynt ein Schlüsselwerk . Es ist ein Übergangswerk von den historischen Dramen Ibsens zu seinen analytischen Gesellschaftsdramen, ein Übergangswerk von der Romantik zum Naturalismus. Auch Ibsens Persönlichkeit hat sich zu der Zeit, als er Peer Gynt schrieb, verändert. Die psychologische Dimension, die sich 100 Jahre nach Ibsens Tod daraus ergibt, mag der Grund sein, warum es so wenig neuere Sekundärliteratur dazu gibt und Peer Gynt noch immer als ein Stück gilt, das schwierig zu inszenieren ist.
Dies liegt sicher auch an dem zahllosen Szenenwechsel, der Hauptgrund dafür ist aber, dass die Interpretation des Stückes so schwierig ist. Schon Ibsen selbst hatte Zweifel, ob das Drama außerhalb Norwegens verstanden werden würde. Ibsen hat als Grundlage für Peer Gynt eine märchenhafte Gestalt aus den Norwegischen Feen- und Volksmärchen verwendet. Es herrschte die Meinung, dass man, um Peer Gynt verstehen zu können, mit den Sagen und Mythen Norwegens vertraut sein müsste und auch die politischen und historischen Hintergründe kennen müsste.
Eine andere Interpretation, die teilweise heute noch vertreten wird, ist, dass es sich bei Peer Gynt um den norwegischen Faust handelt. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, da Goethes Faust nach dem Absoluten sucht, nach dem Sinn des Lebens, hingegen sucht Peer nur nach sich selbst. Ibsen hat in ironischer Weise einige Passagen aus Goethes Faust einfließen lassen und die Frauen sind Schlüsselfiguren in beider Leben, dies könnte eine Erklärung für diese Interpretation sein.
Der Fokus dieser Arbeit liegt nicht auf den oben genannten Interpretationen, sondern auf der psychologischen Dimension dieses Werkes, die sich einerseits aus den Parallelen von Ibsens und Peers Leben, andererseits aus Ibsens Persönlichkeitsveränderung ergibt. Diese [. . .]
Peer Gynt hat in Henrik Ibsens Schaffen einen besonderen Stellenwert. Das dramatische Gedicht wird in der Sekundärliteratur immer wieder als Übergangswerk bezeichnet. Die Dramaturgie ist nur schwer einzuordnen. Es gibt vergleichsweise sehr wenig Sekundärliteratur, vor allem Sekundärliteratur neueren Datums ist kaum zu finden. Dies ist erstaunlich, da es sich bei Peer Gynt um ein Schlüsselwerk handelt, weil es als Vorläufer für das moderne Theater gesehen wird. Es ist, wie Ruprecht Volz schreibt, weit seiner Zeit voraus und nimmt Elemente des Symbolismus, des Expressionismus und des absurden Theaters vorweg.
Doch auch in Ibsens Schaffen ist Peer Gynt ein Schlüsselwerk . Es ist ein Übergangswerk von den historischen Dramen Ibsens zu seinen analytischen Gesellschaftsdramen, ein Übergangswerk von der Romantik zum Naturalismus. Auch Ibsens Persönlichkeit hat sich zu der Zeit, als er Peer Gynt schrieb, verändert. Die psychologische Dimension, die sich 100 Jahre nach Ibsens Tod daraus ergibt, mag der Grund sein, warum es so wenig neuere Sekundärliteratur dazu gibt und Peer Gynt noch immer als ein Stück gilt, das schwierig zu inszenieren ist.
Dies liegt sicher auch an dem zahllosen Szenenwechsel, der Hauptgrund dafür ist aber, dass die Interpretation des Stückes so schwierig ist. Schon Ibsen selbst hatte Zweifel, ob das Drama außerhalb Norwegens verstanden werden würde. Ibsen hat als Grundlage für Peer Gynt eine märchenhafte Gestalt aus den Norwegischen Feen- und Volksmärchen verwendet. Es herrschte die Meinung, dass man, um Peer Gynt verstehen zu können, mit den Sagen und Mythen Norwegens vertraut sein müsste und auch die politischen und historischen Hintergründe kennen müsste.
Eine andere Interpretation, die teilweise heute noch vertreten wird, ist, dass es sich bei Peer Gynt um den norwegischen Faust handelt. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, da Goethes Faust nach dem Absoluten sucht, nach dem Sinn des Lebens, hingegen sucht Peer nur nach sich selbst. Ibsen hat in ironischer Weise einige Passagen aus Goethes Faust einfließen lassen und die Frauen sind Schlüsselfiguren in beider Leben, dies könnte eine Erklärung für diese Interpretation sein.
Der Fokus dieser Arbeit liegt nicht auf den oben genannten Interpretationen, sondern auf der psychologischen Dimension dieses Werkes, die sich einerseits aus den Parallelen von Ibsens und Peers Leben, andererseits aus Ibsens Persönlichkeitsveränderung ergibt. Diese [. . .]
Inhaltsverzeichnis
1;Der Narziss Peer Gynt;1 2;INHALTSVERZEICHNIS;4 3;1. VORWORT;6 4;2. EINE KURZE INHALTSANGABE VON PEER GYNT;10 5;3. DIE BIOGRAFIE VON HENRIK IBSEN BIS ZURENTSTEHUNG VON PEER GYNT;12 5.1;3.1. Frühe Kindheit;12 5.2;3.2. Lehre in Grimstad;15 5.3;3.3. Ibsens Abkehr von seiner Familie;16 5.4;3.4. Theatererfahrungen;18 5.4.1;3.4.1. Bergen;18 5.4.2;3.4.2 Christiania;20 5.5;3.5. Italien;21 5.5.1;3.5.1. Persönlichkeitsveränderung;22 5.6;3.6. Die Entstehung von Peer Gynt;24 6;4. IBSEN und PEER GYNT;27 6.1;4.1. Peer Gynt als Maske des Dichters;27 6.2;4.2. Ibsen, wie er sich selbst sah;33 6.2.1;4.2.1. Ästhetik;37 7;5. EINE PSYCHOANALYTISCHE SICHT AUF PEER GYNT. EIN DRAMATISCHES GEDICHT;39 7.1;5.1. Der Sturz in den Spiegelsee;40 7.2;5.2. Der Narziss Peer Gynt;42 7.3;5.3. Die Selbstfindung des Dichters durch Peer Gynt;54 7.3.1;5.3.1. Ironie als Mittel der Selbstreflexion;60 8;6. VOM LESEDRAMA ZUM BÜHNENSTÜCK;63 8.1;6.1. Das Lesestück: Kritiken und Interpretationen;63 8.2;6.2. Mit Edvard Griegs Musik zur Uraufführung;66 8.3;6.3. Deutsche Übersetzungen;68 8.4;6.4. Die Dramenstruktur;70 9;7. DIE PEYMANN-INSZENIERUNG VON PEER GYNT AM WIENER BURGTHEATER, 1993/94;74 9.1;7.1. Peer Gynt: Regie Claus Peymann. Die Schlüsselinszenierung in Peymanns Burgtheaterdirektion;74 9.1.1;7.1.1. Die Ära Peymann;74 9.1.2;7.1.2 Peer Gynt: Regie Claus Peymann;76 9.2;7.2. Textänderungen;82 9.3;7.3. Bühnenbild, Requisite, Versatzstücke, Kostüme;85 9.4;7.4. Musik;96 9.5;7.5. Die SchauspielerInnen;97 10;8. SCHLUSSWORT;101 11;9. BIBLIOGRAFIE;106 12;10. DANKSAGUNGEN;111 13;Information über die Autorin;112
Produktdetails
Erscheinungsdatum
12. Dezember 2007
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
113
Dateigröße
0,58 MB
Autor/Autorin
Brigitte Fochler
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
ohne Kopierschutz
Produktart
EBOOK
Dateiformat
PDF
ISBN
9783836607391
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Der Narziss Peer Gynt" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.







