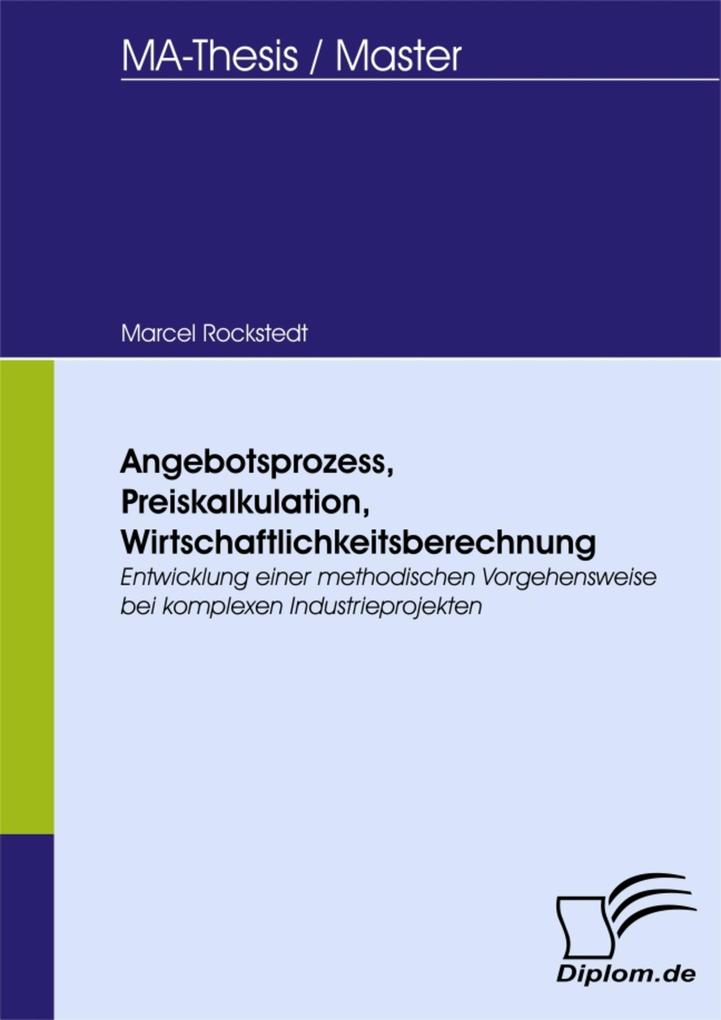
Sofort lieferbar (Download)
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die Automobilindustrie ist heute weltweit einer der wichtigsten Wirtschaftszweige. Auch in Deutschland spielt sie mit einem Umsatz von knapp 230 Mrd. Euro und mehr als 770. 000 Beschäftigten eine entscheidende Rolle im Wirtschaftsleben. Jedoch haben die Auswirkungen der Globalisierung die Automobilindustrie erfasst. In den letzten Jahrzehnten haben sich dramatische Konzentrationsbewegungen auf Seiten der OEM s ergeben. Gab es 1964 noch 52 selbständige Hersteller, so hat sich deren Zahl bis heute auf 12 unabhängige Konzerne reduziert und weitere Zusammenschlüsse sind zu erwarten. Auch bei den Zulieferunternehmen zeichnet sich eine ähnliche Entwicklung ab. Auch hier wird sich die Zahl der Anbieter von weltweit 5. 500 im Jahr 2002 auf ca. 850 im Jahr 2015 praktisch halbieren. Die deutschen Automobilhersteller und deren Zulieferer müssen sich also verstärkt anstrengen, um im internationalen Wettbewerb nicht weiter zurückzufallen. Das professionelle Management von Fahrzeugprojekten über die gesamte Wert-schöpfungskette hinweg wird dabei zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Dies beginnt bereits vor der Umsetzung eines Auftrages. Angebote werden heute häufig zu eigen-ständigen komplexen Projekten, die nicht mehr von einer Person bearbeitet werden kön-nen, sondern ein Projektteam aus unterschiedlichen Fachbereichen notwendig ist. Die Erstellung einer Kalkulation wird zu einer umfangreichen analytischen Aufgabe, die alle Bereiche des Managements in der Konzeption umfasst. Gerade in dieser Phase entscheiden sich neue Aufträge. Die Unternehmen sind gezwungen, Instrumente, Werkzeuge sowie Prozessabläufe zu initiieren, um mit dem Daten- und Zahlenwerk die Angebotsbearbeitung und vor allem die Projektkalkulation erfolgreich zum Ziel zu führen. Gerade die Genauigkeit dieser Kalkulation ist entscheidend für den Erhalt des Auftrages und für den Erfolg des späteren Projektes. Die vorliegende Arbeit hat diese Zielstellung zum Thema. Anhand eines Industrieprojektes aus der Automobilindustrie, wird eine unternehmerische, methodische und analytische Systematik und Vorgehensweise für eine solche Kalkulation entwickelt. Dabei berechnet die Projektkalkulation einen Angebotspreis mit einer anschließenden Wirtschaftlichkeitsanalyse für eine Anfrage der Volkswagen AG an einem neuen Standort in Indien. Dazu sollen zuerst einige Hintergrundinformationen gegeben werden.
Die Volkswagen AG besitzt mittlerweile in vielen Teilen der Welt Standorte. Neben [. . .]
Die Automobilindustrie ist heute weltweit einer der wichtigsten Wirtschaftszweige. Auch in Deutschland spielt sie mit einem Umsatz von knapp 230 Mrd. Euro und mehr als 770. 000 Beschäftigten eine entscheidende Rolle im Wirtschaftsleben. Jedoch haben die Auswirkungen der Globalisierung die Automobilindustrie erfasst. In den letzten Jahrzehnten haben sich dramatische Konzentrationsbewegungen auf Seiten der OEM s ergeben. Gab es 1964 noch 52 selbständige Hersteller, so hat sich deren Zahl bis heute auf 12 unabhängige Konzerne reduziert und weitere Zusammenschlüsse sind zu erwarten. Auch bei den Zulieferunternehmen zeichnet sich eine ähnliche Entwicklung ab. Auch hier wird sich die Zahl der Anbieter von weltweit 5. 500 im Jahr 2002 auf ca. 850 im Jahr 2015 praktisch halbieren. Die deutschen Automobilhersteller und deren Zulieferer müssen sich also verstärkt anstrengen, um im internationalen Wettbewerb nicht weiter zurückzufallen. Das professionelle Management von Fahrzeugprojekten über die gesamte Wert-schöpfungskette hinweg wird dabei zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Dies beginnt bereits vor der Umsetzung eines Auftrages. Angebote werden heute häufig zu eigen-ständigen komplexen Projekten, die nicht mehr von einer Person bearbeitet werden kön-nen, sondern ein Projektteam aus unterschiedlichen Fachbereichen notwendig ist. Die Erstellung einer Kalkulation wird zu einer umfangreichen analytischen Aufgabe, die alle Bereiche des Managements in der Konzeption umfasst. Gerade in dieser Phase entscheiden sich neue Aufträge. Die Unternehmen sind gezwungen, Instrumente, Werkzeuge sowie Prozessabläufe zu initiieren, um mit dem Daten- und Zahlenwerk die Angebotsbearbeitung und vor allem die Projektkalkulation erfolgreich zum Ziel zu führen. Gerade die Genauigkeit dieser Kalkulation ist entscheidend für den Erhalt des Auftrages und für den Erfolg des späteren Projektes. Die vorliegende Arbeit hat diese Zielstellung zum Thema. Anhand eines Industrieprojektes aus der Automobilindustrie, wird eine unternehmerische, methodische und analytische Systematik und Vorgehensweise für eine solche Kalkulation entwickelt. Dabei berechnet die Projektkalkulation einen Angebotspreis mit einer anschließenden Wirtschaftlichkeitsanalyse für eine Anfrage der Volkswagen AG an einem neuen Standort in Indien. Dazu sollen zuerst einige Hintergrundinformationen gegeben werden.
Die Volkswagen AG besitzt mittlerweile in vielen Teilen der Welt Standorte. Neben [. . .]
Inhaltsverzeichnis
1;Angebotsprozess, Preiskalkulation, Wirtschaftlichkeitsberechnung;1 2;Inhaltsverzeichnis;3 3;Abbildungsverzeichnis;6 4;Tabellenverzeichnis;8 5;Abkürzungsverzeichnis;9 6;1. Einleitung;13 6.1;1.1 Einführung in das Thema;13 6.2;1.2 Hintergründe zum Beispielprojekt der Case Study;14 6.3;1.3 Ziele der Arbeit;15 7;2. Modullieferanten in der Automobilzulieferindustrie;18 7.1;2.1 Die Stellung der Modullieferanten in der Automobilindustrie;18 7.2;2.2 Hintergrund zum Beispielunternehmen der Case Study;21 8;3. Theoretische Grundlagen der Kostenträgerrechnungen;22 8.1;3.1 Kostenträgerrechnungen;22 8.1.1;3.1.1 ein- und mehrstufige Divisionskalkulation;25 8.1.2;3.1.2 ein- und mehrstufige Äquivalenzziffernkalkulation;26 8.1.3;3.1.3 summarische und differenzierende Zuschlagskalkulation;27 8.1.4;3.1.4 Zuschlagskalkulation bei Maschinenstundensatzrechnung;29 8.1.5;3.1.5 Kuppelkalkulation;32 8.2;3.2 Weitere Formen von Kalkulationen und Preisberechnungen;33 8.2.1;3.2.1 Kalkulation in der Prozesskostenrechnung;33 8.2.2;3.2.2 Marktorientierte Kalkulationen;35 9;4. Die Planungsstudie als Basis der Kostenermittlung;38 9.1;4.1 Grundlagen der Planungsstudien;38 9.2;4.2 Vorstudien;41 9.2.1;4.2.1 Marktanalyse;41 9.2.2;4.2.2 Opportunitätsstudie;43 9.2.3;4.2.3 Unternehmerische Strategien / Gesellschaftsform;45 9.2.4;4.2.4 Zielprogramm;46 9.3;4.3 Strukturplanung;47 9.3.1;4.3.1 Produktanalyse;47 9.3.2;4.3.2 Produktionskonzept und Groblayout;49 9.3.3;4.3.3 Zeitanalyse;55 9.3.4;4.3.4 Personalbedarf Produktion;59 9.4;4.4 Globalplanung;62 9.4.1;4.4.1 Materialflussplanung;62 9.4.2;4.4.2 Bildung der betrieblichen Bereiche;71 9.4.3;4.4.3 Festlegung des Flächen- und Raumprogramms;75 9.4.4;4.4.4 Ermittlung der Baukosten;77 9.5;4.5 Standortentscheidung;78 9.5.1;4.5.1 Variantenvorstellung und Kostenvergleichsrechnung;80 9.5.2;4.5.2 Definition Nutzwertanalyse;81 9.5.3;4.5.3 Berechnung und Auswertung der Nutzwertanalyse;83 9.6;4.6 Personalkonzept;90 10;5. Aufbau der Kalkulationsstruktur;93 10.1;5.1 Auswahl de
s Kostenrechnungssystems;93 10.2;5.2 Aufbau des Kalkulationsschemas;100 10.3;5.3 Materialkosten;102 10.3.1;5.3.1 Materialeinzelkosten;102 10.3.2;5.3.2 Materialgemeinkosten;103 10.4;5.4 Fertigungskosten;107 10.4.1;5.4.1 Direkte Fertigungspersonalkosten (Fertigungseinzelkosten);107 10.4.2;5.4.2 Indirekte Fertigungspersonalkosten (Fertigungsgemeinkosten);110 10.4.3;5.4.3 Ausschusskosten (Fertigungsgemeinkosten);111 10.4.4;5.4.4 Sonstige Fertigungsgemeinkosten;111 10.5;5.5 Sondereinzelkosten;113 10.5.1;5.5.1 Kalkulatorische Abschreibungen Investitionen Betriebsmittel;113 10.5.2;5.5.2 Planungs-/Projektkosten;116 10.5.3;5.5.3 Anlaufkosten;118 10.5.4;5.5.4 Kalkulatorische Abschreibungen Grundstück / Gebäude / bauliche Einrichtungen;120 10.5.5;5.5.5 Entwicklungs- und Konstruktionskosten;120 10.6;5.6 Herstellkosten (1 und 2);122 10.7;5.7 Selbstkosten;123 10.7.1;5.7.1 Indirekte Personalkosten;123 10.7.2;5.7.2 Sonstige Verwaltungsgemeinkosten;125 10.7.3;5.7.3 Sonstige Vertriebsgemeinkosten;126 10.8;5.8 Gewinnzuschlag;126 10.9;5.9 Finanzierungskosten/Verzinsung;126 10.10;5.10 Preisberechnung und Pricing;131 11;6. Entwicklung von Instrumenten zur Entscheidungsfindung;136 11.1;6.1 Überblick;136 11.2;6.2 Kapitalwertmethode;139 11.3;6.3 Amortisationsmethode;142 11.4;6.4 Value Driver-Berechnung nach RAPPAPORT;143 11.5;6.5 Cash-flow Return on Investment (CFROI) vs. Return on Investment (ROI);146 11.6;6.6 Economic Value Added (EVA );150 11.7;6.7 Unsicherheiten bei Auslandsinvestitionen;155 11.7.1;6.7.1 Allgemeine Auslandsunsicherheiten;155 11.7.2;6.7.2 Spezifische Auslandsunsicherheiten;156 11.7.3;6.7.3 Maßnahmen zur Reduzierung der Unsicherheit;161 11.7.4;6.7.4 Finanzinstrumente zur Reduzierung der Wechselkursunsicherheiten;163 11.7.5;6.7.5 Sensitivitätsanalysen bei Auslandsinvestitionen;166 12;7. Umsetzung des Projektes Anforderungen an Projektleiter/innen;174 12.1;7.1 Aufbau der Projektstruktur;174 12.2;7.2 Die Projektleitung als zentrale Führungsfunktion;177 12.3;7.3 Das Projektte
am;179 13;8. Fazit und Ausblick;184 14;Anlagen;187 14.1;Anlage 1: Darstellung der Möglichkeiten einer Gesellschaftskonstellation in Indien;188 14.2;Anlage 2: Zielprogramm des Beispielunternehmens;196 14.3;Anlage 3: Stückliste Basisausstattung;199 14.4;Anlage 4: Technologischer Ablauf der Produktion;201 14.5;Anlage 5: Behälter für die Logistikkalkulation;202 14.6;Anlage 6: Flächenprogramm des neuen Betriebes;203 14.7;Anlage 7: Nutzwertanalyse zur Standortentscheidung;204 14.8;Anlage 8: Investitionsprogramm Betriebsmittel;208 14.9;Anlage 9: Wirtschaftlichkeitsberechnungen;209 15;Literaturverzeichnis;214
s Kostenrechnungssystems;93 10.2;5.2 Aufbau des Kalkulationsschemas;100 10.3;5.3 Materialkosten;102 10.3.1;5.3.1 Materialeinzelkosten;102 10.3.2;5.3.2 Materialgemeinkosten;103 10.4;5.4 Fertigungskosten;107 10.4.1;5.4.1 Direkte Fertigungspersonalkosten (Fertigungseinzelkosten);107 10.4.2;5.4.2 Indirekte Fertigungspersonalkosten (Fertigungsgemeinkosten);110 10.4.3;5.4.3 Ausschusskosten (Fertigungsgemeinkosten);111 10.4.4;5.4.4 Sonstige Fertigungsgemeinkosten;111 10.5;5.5 Sondereinzelkosten;113 10.5.1;5.5.1 Kalkulatorische Abschreibungen Investitionen Betriebsmittel;113 10.5.2;5.5.2 Planungs-/Projektkosten;116 10.5.3;5.5.3 Anlaufkosten;118 10.5.4;5.5.4 Kalkulatorische Abschreibungen Grundstück / Gebäude / bauliche Einrichtungen;120 10.5.5;5.5.5 Entwicklungs- und Konstruktionskosten;120 10.6;5.6 Herstellkosten (1 und 2);122 10.7;5.7 Selbstkosten;123 10.7.1;5.7.1 Indirekte Personalkosten;123 10.7.2;5.7.2 Sonstige Verwaltungsgemeinkosten;125 10.7.3;5.7.3 Sonstige Vertriebsgemeinkosten;126 10.8;5.8 Gewinnzuschlag;126 10.9;5.9 Finanzierungskosten/Verzinsung;126 10.10;5.10 Preisberechnung und Pricing;131 11;6. Entwicklung von Instrumenten zur Entscheidungsfindung;136 11.1;6.1 Überblick;136 11.2;6.2 Kapitalwertmethode;139 11.3;6.3 Amortisationsmethode;142 11.4;6.4 Value Driver-Berechnung nach RAPPAPORT;143 11.5;6.5 Cash-flow Return on Investment (CFROI) vs. Return on Investment (ROI);146 11.6;6.6 Economic Value Added (EVA );150 11.7;6.7 Unsicherheiten bei Auslandsinvestitionen;155 11.7.1;6.7.1 Allgemeine Auslandsunsicherheiten;155 11.7.2;6.7.2 Spezifische Auslandsunsicherheiten;156 11.7.3;6.7.3 Maßnahmen zur Reduzierung der Unsicherheit;161 11.7.4;6.7.4 Finanzinstrumente zur Reduzierung der Wechselkursunsicherheiten;163 11.7.5;6.7.5 Sensitivitätsanalysen bei Auslandsinvestitionen;166 12;7. Umsetzung des Projektes Anforderungen an Projektleiter/innen;174 12.1;7.1 Aufbau der Projektstruktur;174 12.2;7.2 Die Projektleitung als zentrale Führungsfunktion;177 12.3;7.3 Das Projektte
am;179 13;8. Fazit und Ausblick;184 14;Anlagen;187 14.1;Anlage 1: Darstellung der Möglichkeiten einer Gesellschaftskonstellation in Indien;188 14.2;Anlage 2: Zielprogramm des Beispielunternehmens;196 14.3;Anlage 3: Stückliste Basisausstattung;199 14.4;Anlage 4: Technologischer Ablauf der Produktion;201 14.5;Anlage 5: Behälter für die Logistikkalkulation;202 14.6;Anlage 6: Flächenprogramm des neuen Betriebes;203 14.7;Anlage 7: Nutzwertanalyse zur Standortentscheidung;204 14.8;Anlage 8: Investitionsprogramm Betriebsmittel;208 14.9;Anlage 9: Wirtschaftlichkeitsberechnungen;209 15;Literaturverzeichnis;214
Produktdetails
Erscheinungsdatum
01. Juli 2008
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
227
Dateigröße
12,15 MB
Autor/Autorin
Marcel Rockstedt
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
ohne Kopierschutz
Produktart
EBOOK
Dateiformat
PDF
ISBN
9783836615082
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Angebotsprozess, Preiskalkulation, Wirtschaftlichkeitsberechnung" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.







