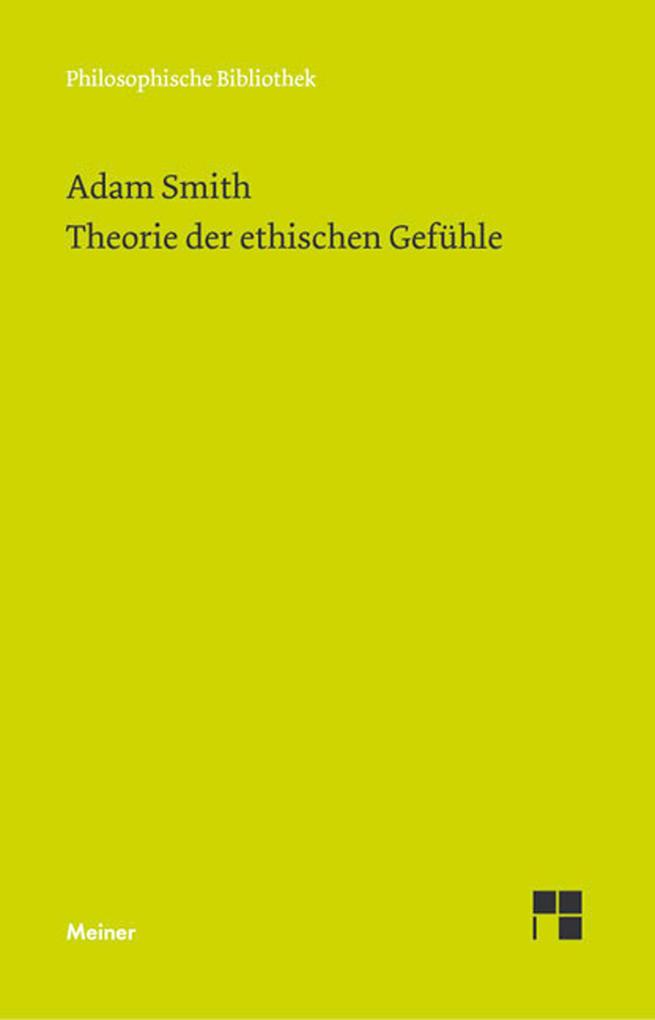
Sofort lieferbar (Download)
Mit seinem philosophischen Hauptwerk, der "Theorie der ethischen Gefühle", legte Adam Smith den Grundstein für die Ausbildung einer Moralphilosophie, die sich ausdrücklich auf die Ideen der Sympathie und der Solidargemeinschaft beruft. Die Gründung der Moral auf den Begriff des Mitgefühls oder der "Sympathie" steht im Zentrum des philosophischen Hauptwerks von Adam Smith (1723-1790), der 1759 publizierten Schrift "The Theory of Moral Sentiments". Methodisch orientiert an den Werken der englischen Empiristen Shaftesbury, Mandeville, Hutcheson und Hume, untersucht Smith die Moralsysteme der Vergangenheit, kritisiert die Bemühungen seiner Zeitgenossen um eine Grundlegung der Moralphilosophie und nimmt so zukünftige wichtige Ansätze auf dem Gebiet der Ethik vorweg; sein Werk ist ein Sammelplatz heterogenster, scheinbar konträrer Richtungen der Moralphilosophie. Es kombiniert unterschiedliche Theorien zu einem bemerkenswerten System des "sittlich Richtigen", das sich nicht an Kriterien wie dem der Nützlichkeit ausrichtet, sondern an der Konvention des ausgebildeten Mitgefühls. Der zentrale Begriff ist dabei "Sympathie", ergänzt durch die Einführung der Idee eines unparteiischen Zuschauers, in den sich laut Smith jeder einzelne immer dann versetzt, wenn er moralische Entscheidungen zu treffen hat: "Der impartial spectator läßt die Individuen überlegen, daß sie an der Stelle desjenigen stehen könnten, dem sie ihre Sympathie zuwenden. Daraus entsteht nach Smith ein Motiv, aktuell so zu handeln, wie man an dessen Stelle behandelt werden wollte" (B. Priddat). "The Theory of Moral Sentiments" wurde mehrfach überarbeitet und ergänzt; diese Ausgabe bietet den Text in der letzten Fassung nach der 6. Auflage von 1790 in der deutschen Übersetzung von W. Eckstein.
Inhaltsverzeichnis
1;INHALT;6 2;ZU DIESER AUSGABE;14 3;EINLEITUNG;16 4;BIBLIOGRAPHIE;58 5;Über die Schicklichkeit oder sittliche Richtigkeit der Handlungen;70 5.1;ERSTER ABSCHNITT;70 5.2;ZWEITER ABSCHNITT;102 5.3;DRITTER ABSCHNITT;131 6;Von Verdienst und Schuld oder von den Gegenständen der Belohnung und Bestrafung;168 6.1;ERSTER ABSCHNITT;168 6.2;ZWEITER ABSCHNITT;189 6.3;DRITTER ABSCHNITT;212 7;Über die Grundlage der Urteile, die wir über unsere eigenen Gefühle und unser eigenes Verhalten fällen, und über das Pflichtgefühl.;242 8;Über den Einfluß der Nützlichkeit auf das Gefühl der Billigung;352 9;Von dem Einfluß, welchen der Brauch und die Mode auf die Empfindungen der sittlichen Billigung und Mißbilligung üben.;378 10;Wen nennen wir tugendhaft?;408 10.1;ERSTER ABSCHNITT;408 10.2;ZWEITER ABSCHNITT;418 10.3;DRITTER ABSCHNITT;451 11;Über einige Systeme der Moralphilosophie;500 11.1;ERSTER ABSCHNITT;500 11.2;ZWEITER ABSCHNITT;502 11.3;DRITTER ABSCHNITT;580 11.4;VIERTER ABSCHNITT;602 12;ANMERKUNGEN DES HERAUSGEBERS;630 13;NAMENREGISTER;666
Produktdetails
Erscheinungsdatum
01. Mai 2010
Sprache
deutsch
Auflage
Unverändertes eBook der 1. Auflage von 2010
Seitenanzahl
604
Dateigröße
3,05 MB
Reihe
Philosophische Bibliothek
Autor/Autorin
Adam Smith
Herausgegeben von
Horst D. Brandt
Vorwort
Walther Eckstein
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
PDF
ISBN
9783787322053
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Theorie der ethischen Gefühle" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.







