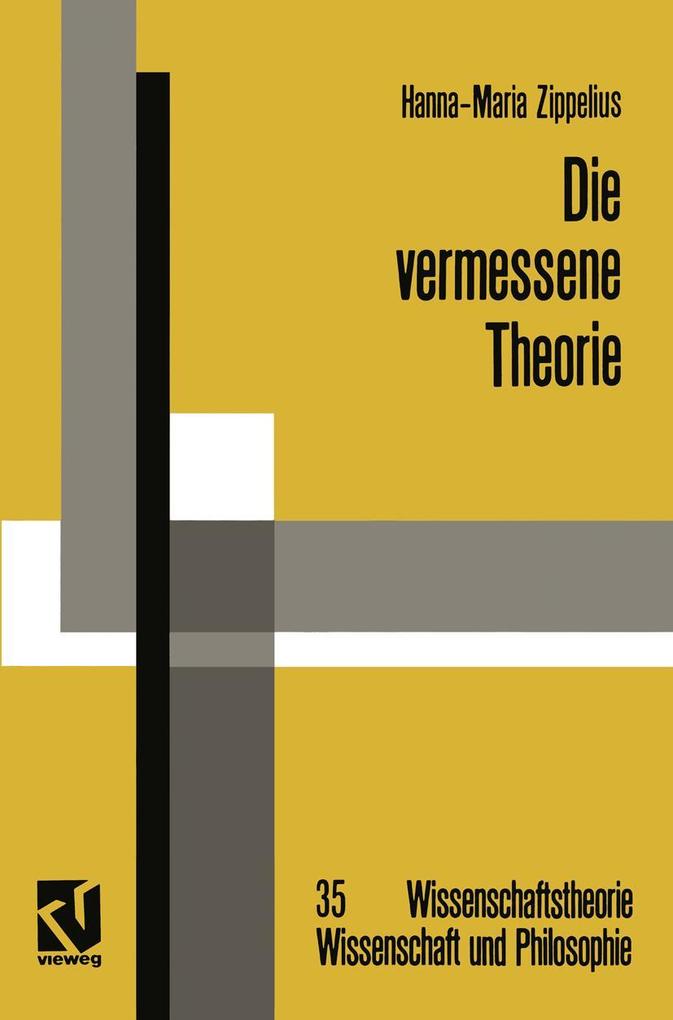I Die theroretischen Grundlagen der Verhaltensforschung nach Konrad Lorenz.- 1. Die physiologische Theorie der Instinktbewegung.- 2. Das Prinzip der doppelten Quantifizierung.- 3. Appetenzverhalten und das Konzept der Endhandlung.- 4. Das Zusammenwirken von Erbkoordinationen.- 5. Die modifizierte Instinkttheorie.- 6. Allgemeine Bemerkungen zur Theorie von Konrad Lorenz.- 7. Das Neue der Lorenzschen Theorie.- II Eine kritische Analyse der Annahmen der Theorie.- 1. Allgemeine Bemerkungen zu einer Motivationstheorie.- 2. Die Besonderheiten der Motivationstheorie von Konrad Lorenz.- 3. Die Schlüsselreiztheorie - ein einheitliches Konzept?.- 4. Methodische Probleme.- 5. Vorhersagen der Lorenzschen Theorie.- 6. Der Begriff 'angeboren' in der Theorie von Konrad Lorenz.- III Was wissen wir nun wirklich? Eine kritische Analyse empirischer Befunde.- 1. Die Erbkoordination.- 2. Der angeborene Erkennungsmechanismus.- 3. Die gesetzmäßigen Schwankungen der Bereitschaft.- 4. Eine Fallstudie zum Prinzip der doppelten Quantifizierung: Balzverhalten beim Guppy.- 5. Motivierende und demotivierende Reize.- 6. Inkongruenzen und ad hoc Anpassungen..- IV Das Zusammenwirken von Erbkoordinationen.- 1. Das Konzept der 'relativen Stimmungshierarchie'.- 2. Das Konzept der Endhandlung von Hassenstein.- 3. Das Modell des Maximalwertdurchlasses.- 4. Das Modell der 'Hierarchie der Instinktzentren' von Tinbergen.- 5. Modelle zum Übersprungverhalten.- V: Klassische Ethologie und moderne Verhaltensökologie - Gegensatz oder Ergänzung?.- Sachwortregister.
Inhaltsverzeichnis
I Die theroretischen Grundlagen der Verhaltensforschung nach Konrad Lorenz. - 1. Die physiologische Theorie der Instinktbewegung. - 2. Das Prinzip der doppelten Quantifizierung. - 3. Appetenzverhalten und das Konzept der Endhandlung. - 4. Das Zusammenwirken von Erbkoordinationen. - 5. Die modifizierte Instinkttheorie. - 6. Allgemeine Bemerkungen zur Theorie von Konrad Lorenz. - 7. Das Neue der Lorenzschen Theorie. - II Eine kritische Analyse der Annahmen der Theorie. - 1. Allgemeine Bemerkungen zu einer Motivationstheorie. - 2. Die Besonderheiten der Motivationstheorie von Konrad Lorenz. - 3. Die Schlüsselreiztheorie ein einheitliches Konzept? . - 4. Methodische Probleme. - 5. Vorhersagen der Lorenzschen Theorie. - 6. Der Begriff `angeboren in der Theorie von Konrad Lorenz. - III Was wissen wir nun wirklich? Eine kritische Analyse empirischer Befunde. - 1. Die Erbkoordination. - 2. Der angeborene Erkennungsmechanismus. - 3. Die gesetzmäßigen Schwankungen der Bereitschaft. - 4. Eine Fallstudie zum Prinzip der doppelten Quantifizierung: Balzverhalten beim Guppy. - 5. Motivierende und demotivierende Reize. - 6. Inkongruenzen und ad hoc Anpassungen. . - IV Das Zusammenwirken von Erbkoordinationen. - 1. Das Konzept der `relativen Stimmungshierarchie . - 2. Das Konzept der Endhandlung von Hassenstein. - 3. Das Modell des Maximalwertdurchlasses. - 4. Das Modell der `Hierarchie der Instinktzentren von Tinbergen. - 5. Modelle zum Übersprungverhalten. - V: Klassische Ethologie und moderne Verhaltensökologie Gegensatz oder Ergänzung? . - Sachwortregister.