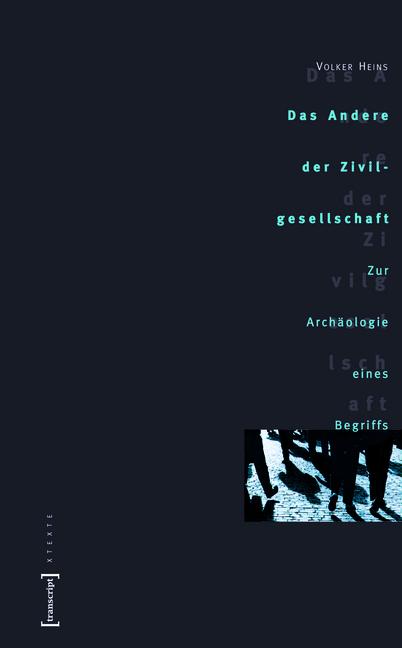Besprochen in:Ökologie und Lernen, (2004), Friedrun Erben
»Die Idee des Autors ist [es], [. . .] einen Beitrag zur intellectual history des Zivilgesellschaftskonzeptes zu leisten und eine Konkretisierung und Neubestimmung des Konzeptes voranzutreiben. Wichtig bei der Bestimmung des Begriffes war es immer offen zu legen, von wo aus eine Zivilgesellschaft definiert wird. Wird sie zur positiven Selbstidentifikation einzelner Gruppen missbraucht oder als Ausdruck verschiedener Theorieströmungen genutzt. Auch hier will der Autor Klarheit schaffen. Der vorliegende Band bietet eine interessante Auseinandersetzung mit einem Phänomen unserer Zeit. Dabei belässt der Autor es nicht bei einer Beschreibung, sondern macht seine Überlegungen nutzbar für eine Neuorientierung zukünftiger Gesellschaftsbeschreibungen. « Friedrun Erben, Ökologie und Lernen, (2004)
»Das große Verdienst Volker Heins ist es, in einem neuen Essay, in einer Archäologie des Begriffes Zivilgesellschaft auf den Missbrauch, auf die Entwicklung dieses Wortes vom historischen Kampfbegriff zur Worthülse hingewiesen zu haben. Heins erschließt die wahre Bedeutung, indem er die Gegenbilder aufzeigt, zwischen die sich die Zivilgesellschaft ursprünglich stellt und gegen die sich das, was die Zivilgesellschaft abbilden soll, behaupten muss. Methodologisch fühlt sich der Leser durchaus an Popper erinnert. « Ulrich F. Brömmling, Deutsche Stiftungen, 1 (2003)
»Der [. . .] Politikwissenschaftler Heins setzt in seinem Essay [. . .] einige auch unter soziologischen Gesichtspunkten interessante Kontrapunkte. Er nutzt ideen- und theoriegeschichtliche Gegenbegriffe zur geläufigen Vorstellung von friedlich-toleranten und sozial inklusiven Zivilgesellschaften zur Demonstration einer strukturell ambivalenten Funktionsweise assoziativer Praxis. « Ingo Bode, Soziologische Revue, 3/7 (2006)