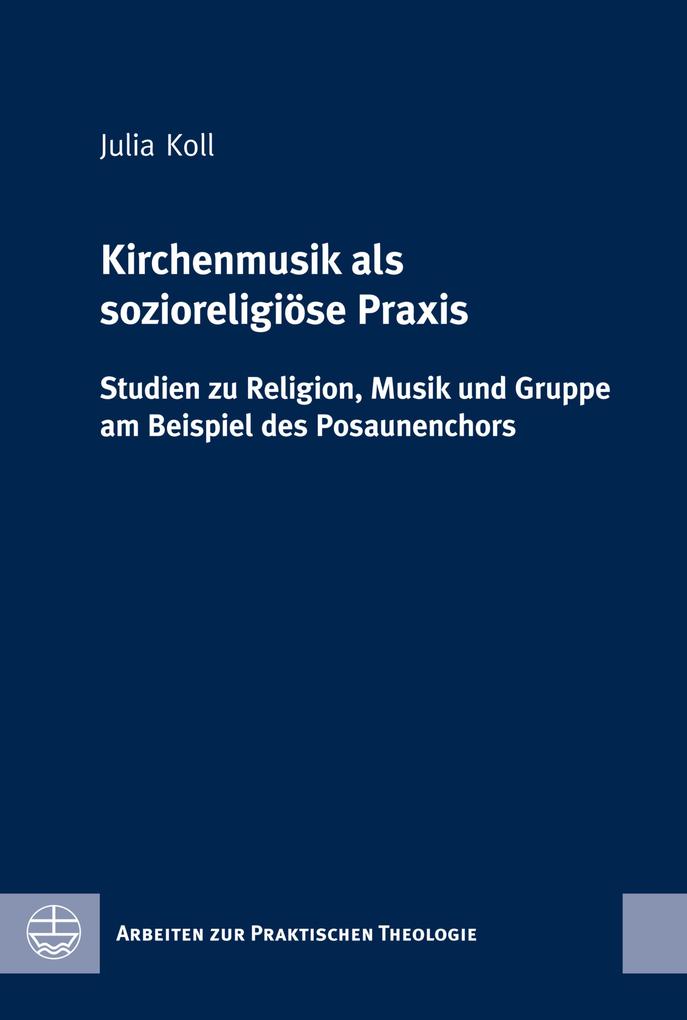Ausgehend von einer norddeutschen Mitgliederbefragung thematisiert die Untersuchung den Posaunenchor als exemplarische kirchliche Praxis und fragt, wie sich hier soziale, musikalische und religiöse Aspekte miteinander verbinden. Am Anfang steht dabei die Dynamisierung und Sozialisierung eines individualistisch enggeführten Religionsbegriffs durch den Begriff der Praxis der Selbsttranszendenz.
Mit Hilfe musikwissenschaftlicher Konzepte entwirft Koll sodann eine Theorie kirchlichen Musizierens, die sowohl die Rolle des instrumentalen Musizierens als auch des Gottesdienstes neu bewertet. Schließlich wird der Posaunenchor als kirchliche Gruppe mittels jüngerer gruppensoziologischer Ansätze thematisiert. Am Phänomen der Posaunenchorpraxis lässt sich auch der Zusammenhang von Gruppe und kirchlicher Organisation erhellen und zeigen, dass und inwiefern letztere zur Pflege einer homogenen und überzeugenden Gruppenidentität beitragen kann.
Inhaltsverzeichnis
INHALT
I. Einleitung 11
1. Thematische Hinfu hrung 13
1.1. Posaunencho re: Zur Geschichte eines evangelischen Pha nomens 13
1.2. Zum Forschungsstand 25
1.3. Zu Fragestellung und Aufbau dieser Arbeit 30
2. Methodologische U berlegungen 32
2.1. Zum Forschungsinteresse 32
2.2. Ein doppelt praxistheoretischer Forschungsansatz 34
2.2.1. Praxis als Gegenstand, Theorie als Praxis 34
2.2.2. Die Forscherin und das Feld 43
2.3. Zur empirischen Untersuchung 46
2.3.1. Zur Entwicklung des quantitativ-empirischen Forschungsdesigns 46
2.3.2. Vorbereitung und Durchfu hrung der Posaunenchorbefragung 2012 48
2.3.3. Zur Fragebogenkonstruktion 51
2.3.4. Das Datenmaterial 55
2.4. Praktisch-theologische Theoriebildung aus quantitativ-empirischen Daten 56
2.4.1. Praktische Theologie als empirische Religionsforschung? 56
2.4.2. Praxistheoretische Dynamisierung: Zur Auswertung der empirischen Untersuchung 64
2.4.3. Zusammenfassung: Das theologisch-methodologische Konzept dieser Arbeit 67
II. Empirische Erkundungen 71
3. Posaunencho re heute 73
3.1. Die Mitglieder 73
3.2. Die Cho re und ihre Leiter/innen 79
3.3. Die Praxis der Posaunencho re 83
3.4. Was ist das Besondere? 85
3.5. Posaunencho re in Ost- und Westdeutschland 87
3.6. Zusammenfassung 89
4. Empirische Befunde zu Religion, Musik und Gruppe 91
4.1. Zur Motivation der Posaunenchormitglieder 91
4.2. Zur Bedeutung der Musik fu r Bla ser/innen und Posaunenchorpraxis 97
4.3. Bla ser/innen und ihr Verha ltnis zur kirchlichen Organisation 103
4.4. Posaunenchor und Religion im Selbstversta ndnis der Bla ser/innen 109
4.5. Der Posaunenchor als Gruppe 115
4.6. Zusammenfassung 122
III. Theoretische Erkundungen 125
5. Religionstheoretische Perspektive: Posaunenchor Religion als kollektive Praxis 127
5.1. Zum Religionsbegriff in der gegenwa rtigen Diskussion 128
5.1.1. »Religion« ein praktisch-theologischer Leitbegriff? 128
5.1.2. Religion und Religiosita t 136
5.1.3. Religio se Individualisierung ein wirkma chtiges Theorem 143
5.1.4. Fazit 152
5.2. Selbsttranszendenz Deutung Praxis: Religionstheoretische Pointen 154
5.2.1. Hans Joas ein religionssoziologischer Gespra chspartner 154
5.2.2. Zu Joas Begriff der Selbsttranszendenz 156
5.2.3. Zwischen Erfahren und Deuten: Joas religionstheoretische Gedanken 168
5.2.4. Praxis der Selbsttranszendenz: Eine praxistheoretische Erweiterung 172
5.3. Religion im Posaunenchor 181
5.3.1. Selbsttranszendenz im Posaunenchor 182
5.3.2. Der Posaunenchor als offene und stetige Praxis 184
5.3.3. Kollektive und individuelle Religion 185
5.4. Konsequenzenfu reinepraktisch-theologischeReligionstheorie.188
6. Kirchenmusiktheoretische Perspektive: Gemeinsames Musizieren als religio se Praxis 192
6.1. Auf dem Weg zu einer praktisch-theologischen Kirchenmusiktheorie 192
6.2. Von der Musik zum Musizieren 203
6.2.1. Von der Autonomie der Musik zur New Musicology 203
6.2.2. »Working musically with people in context« eine musikpsychologische Perspektive 208
6.2.3. Das Modell des »Collaborative Musicing« 212
6.2.4. Implikationen fu r den Gemeinschafts- und den Praxisbegriff 217
6.2.5. Gemeinsames Musizieren im Posaunenchor 224
6.3. Jenseits der Worte: Zur Bedeutung instrumentaler Kirchenmusik 229
6.3.1. Instrumentalmusik als musiktheologischer Ernstfall 229
6.3.2. Was bedeutet Musik? Musikphilosophische Perspektiven 239
6.3.3. Theophonie: Zum religionsproduktiven Potential instrumentaler Musik 245
6.3.4. Der Posaunenchor als instrumentalmusikalisches Ensemble 252
6.4. Musizieren im Gottesdienst 256
6.4.1. Bla ser/innen und der Gottesdienst 258
6.4.2. Gottesdienst als Gelegenheit zur Performance 262
6.4.3. Musizieren als gottesdienstliche Beteiligung 265
6.4.4. Gottesdienstliches Musizieren und religio se Deutung 268
6.4.5. Gottesdienst Mitte des kirchenmusikalischen Lebens? 272
6.5. Konsequenzen fu r eine praktisch-theologische Kirchenmusiktheorie 279
7. Kirchentheoretische Perspektive: Die Gruppe Posaunenchor als kirchliche Praxis 283
7.1. Gruppeinpraktisch-theologischer Perspektive. Einleitende Bemerkungen 283
7.2. Die Gruppe Posaunenchor als organisierte religio se Praxis 293
7.2.1. Zur Typologie kirchlicher Gruppen bei Hauschildt/Pohl-Patalong 293
7.2.2. Posaunenchor zwischen Organisation und Interaktion 296
7.2.3. Gruppe und Religion am Beispiel des Posaunenchors 306
7.3. Gruppe in soziologischer Perspektive 311
7.3.1. Die Mesoebene des Sozialen: Ein Forschungsu berblick 311
7.3.2. Gruppen im Wandel 322
7.3.3. Gruppe oder Netzwerk? 327
7.3.4. Gruppe gleich Gemeinschaft? 330
7.3.5. Der Posaunenchor in gruppensoziologischer Sicht 336
7.4. Konsequenzen fu r eine praktisch-theologische Theorie kirchlicher Gruppen 342
IV. Ausblick 349
1. Posaunenchor als Praxis 351
2. Praktiken im praktisch-theologischen Fokus 354
3. Zur Bedeutung intersubjektiver Praktiken 360
4. Praktiken und Diskurse 364
5. Methodologische Konsequenzen 369
6. Theologische Implikationen der Erforschung von Praktiken 372
7. Ein neuer Leitbegriff? 377
V. Literaturverzeichnis 379
VI. Anhang 406
1. Statistische Abku rzungen 407
2. Fragebogen fu r Chormitglieder 408
3. Fragebogen fu r Chorleiter 416