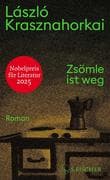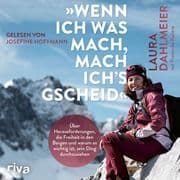Das Buch "Toneurythmie im Lichte der Musikwissenschaft" beschäftigt sich mit dem Phänomen der Toneurythmie aus musiksemiotischer Sicht. In der Einleitung wird auf das Verhältnis der Wissenschaft zur Kunst der Eurythmie eingegangen mit der Feststellung, dass es bislang kaum wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit dieser Körperbewegungskunst gab. Um diese Forschungslücke zu schließen, wird im Hinblick auf die Toneurythmie als Teilbereich der eurythmischen Kunst das Ziel der Abhandlung formuliert, nämlich einen allgemeinen wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn anzustreben sowie das Entwicklungspotential toneurythmischer und musikalischer Ausdrucksmittel aufzuzeigen. Eine praktische Anwendbarkeit der erlangten Erkenntnisse ist ein wesentlicher Bestandteil der Abhandlung. Als wissenschaftliches Mittel werden die Methoden der Musiksemiotik angewendet, welche ein interdisziplinärer Wissenschaftszweig ist. Die Musiksemiotik vereint musikwissenschaftliche Systematik mit den Grundkonzepten der Zeichenwissenschaft (Semiotik). Nach dem Quellen- und Literaturüberblick werden allgemeine Fragen formuliert: Was ist Eurythmie? Wie lässt sich Toneurythmie musiksemiotisch beschreiben? Als Antworten folgen die Kapitel "99 Jahre Eurythmie: von 1908 bis 2007" mit einer Entstehungschronik dieser Kunst sowie "Methodenentwicklung zu einer musiksemiotischen Analyse der Toneurythmie" in welchem das triadische Zeichen-Modell von Charles Sanders Peirce als Methode zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung gewählt wird. Des Weiteren wird das Zeichensystem (Gestik) der Toneurythmie aus musiksemiotischer Sicht analysiert. Folgende Grundelemente werden einzeln betrachtet: die Dur-Skala, die Moll-Skala, die Chromatik, Intervalle, Dur und Moll, Akkorde (konsonierende Dreiklänge und deren Umkehrungen, Dissonanzen und Septakkorde). Auf Basis der Analyse werden einige Entwicklungsmöglichkeiten der toneurythmischen Gestik vorgeschlagen, z. B. ein Zeichensystem für die Kirchentonarten und Möglichkeiten der Anwendung von zwölf , absoluten' Tongesten zur Darstellung von Zwölftonmusik. Für das praktische Musizieren lassen sich folgende Entwicklungen ableiten: das Komponieren von Musik in Hinblick auf das Verhältnis der Anzahl der Stufen einer Tonleiter und ihrer metrischen Organisation, ein neuartiges komplexes System der achtstufigen Skalen (hier , Yin-Yang-Skalen' genannt) sowie die Argumentation für die Natürlichkeit der a1 = 432 Hz Stimmung. Im Fazit werden einige weitere Möglichkeiten der kreativen Anwendung von Zeichenwissenschaft in Bezug auf Toneurythmie und Musik angesprochen und somit weitere Perspektiven eröffnet. Die Abhandlung ist umfangreich illustriert - sie enthält 19 Notenbeispiele, 25 Tabellen und 23 Abbildungen darunter auch seltene Photos von einzelnen toneurythmischen Gebärden.
Inhaltsverzeichnis
1;Toneurythmie im Lichteder Musikwissenschaft Eine musiksemiotische Analyse sowie Anregungenzum praktischen Musizieren und Eurythmisieren;1 1.1;Inhaltsverzeichnis;4 1.2;1 Einleitung;6 1.2.1;1.1 Zum Verhältnis der Wissenschaft zur Eurythmieund zum Ziel der Abhandlung;6 1.2.2;1.2 Quellen- und Literaturüberblick;9 1.3;2 Allgemeine Fragestellungen;11 1.3.1;2.1 Was ist Eurythmie?Eine Kurzbeschreibung der Erscheinungsformen;11 1.3.2;2.2 Was ist Musiksemiotik?Zum Verhältnis von Musikwissenschaft und Semiotik;15 1.4;3 99 Jahre Eurythmie: von 1908 bis 2007Eine Entstehungschronik mit besonderer Berücksichtigungder toneurythmischen Entwicklung;20 1.5;4 Methodenentwicklung zu einer musiksemiotischenAnalyse der Toneurythmie;33 1.6;5 Das Zeichensystem der ToneurythmieEine musiksemiotische Analyse der Grundelemente;40 1.6.1;5.1 Eurythmie-Tonskala: Tonleiter und Tonspirale;40 1.6.1.1;5.1.1 Die Dur-Skala;40 1.6.1.2;5.1.2 Die Moll-Skala;46 1.6.1.3;5.1.3 Die Chromatik;49 1.6.1.4;5.1.4 Zum Verhältnis der Anzahl der Stufen in einer Tonleiter und dermetrischen Organisation der Musik;65 1.6.1.5;5.1.5 Entwicklung einer modalen Gestik;66 1.6.2;5.2 Intervalle und deren physiologische Grundlage;71 1.6.2.1;5.2.1 Intervallerlebnisse;71 1.6.2.2;5.2.2 Intervallgebärden;74 1.6.2.3;5.2.3 Intervallschritte;79 1.6.2.4;5.2.5 Weitere Aspekte der Intervallgestik und die chromatischeIntervalltabelle;81 1.6.2.5;5.2.6 Yin-Yang-Skalen: Versuch einer Übertragung der eurythmischenPrinzipien in das musiktheoretische Denken;84 1.6.2.6;5.2.7 Yin-Yang-Skalen: praktische Anwendbarkeit;91 1.6.3;5.3 Dur und Moll in der Eurythmie: Akkorde;96 1.6.3.1;5.3.1 Dur- und Moll-Eurythmiefiguren: konsonierende Dreiklänge;96 1.6.3.2;5.3.2 Umkehrungen der konsonierenden Dreiklänge;100 1.6.3.3;5.3.3 Dissonanzgebärde und Septakkorde;100 1.6.4;5.4 Stimmung in a1 = 432 Hz und deren eurythmische Grundlage;103 1.7;6 Fazit;108 1.8;Literaturverzeichnis;114 1.9;Weiterführende Literatur;117 1.10;Abbildungsverzeichnis;119 1.11;Tabellenverz
eichnis;120 1.12;Verzeichnis der Notenbeispiele;121