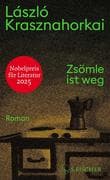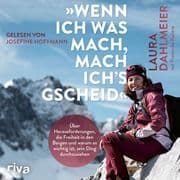Mit ihrer Arbeit Zum Glück in der Schule schafft Michaela Dimbath eine Grundlage zur Thematisierung von , Glück' im Kontext der Grundschule. Nach einem umfassenden Überblick über Glückskonzeptionen aus Philosophie und Psychologie stellt sie eine eigene kleine explorative-qualitative Untersuchung zu Glückskonzeptionen bei Grundschulkindern vor. Neben , offenen' Kurzfragebögen, die in dritten und vierten Klassen in sozioökonomisch unterschiedlich gestellten Wohnquartieren eingesetzt wurden, bildet eine Reihe von Schüleraufsätzen zum Thema , Glück' einen zweiten Interpretationszugang. Den Befunden sind Hinweise darauf zu entnehmen, dass Glück nicht nur an sehr unterschiedlichen Gegenständen festgemacht wird, sondern dass Glücksempfinden auch schicht- oder milieuspezifisch zu variieren scheint. Damit werden nicht nur für die Glücksforschung neue Fragen aufgeworfen. Mit Blick auf Grundschuldidaktische Überlegungen zeigt die Arbeit darüber hinaus, dass die unterrichtliche Reflexion über Glück weiterer Differenzierung bedarf. Zudem wird von der Autorin dargestellt, welchen Stellenwert Schule und Unterricht im Glücksempfinden der Grundschulkinder haben können. Sowohl in didaktischer als auch unter schulkultureller Hinsicht gibt die Arbeit wertvolle Anregungen, die die Entwicklung eines , glücklichen' Schulalltags einfordern.
Inhaltsverzeichnis
1;Vorwort;3 2;Inhalt;4 3;1. Einleitung;5 4;2. Theoretische Grundlegungen;9 4.1;2.1 Philosophische Glückskonzepte und Glückslehren;9 4.1.1;2.1.1 Antike;9 4.1.2;2.1.2 Mittelalter;12 4.1.3;2.1.3 Neuzeit;14 4.1.4;2.1.4 Gegenwärtiges Glücksverständnis;16 4.2;2.2 Versuch der Konkretisierung des Glücksbegriffs;16 4.2.1;2.2.1 Das Glückserleben;17 4.2.2;2.2.2 Zusammenhang zwischen Glück, Freude, flow und Spaß;18 4.3;2.3 Zur Psychologie der Emotionen Glückspsychologie;21 5;3. Annäherung an das Kindheitsglück;24 5.1;3.1 Kindheit;24 5.1.1;3.1.1 Pädagogische Sicht der Kindheit;25 5.1.2;3.1.2 Entwicklungspsychologische Sicht der Kindheit;26 5.1.3;3.1.3 Soziokulturelle Sicht der Kindheit;26 5.2;3.2 Verklärung von Kindheitsglück bei Erwachsenen;27 6;4. Überblick über den gegenwärtigen Forschungsstand;29 6.1;4.1 Kindheitsforschung;29 6.2;4.2 Glücksforschung118;30 6.3;4.3 Kinderglückforschung;32 7;5. Glücksforschung mit qualitativenErhebungsstrategien;45 7.1;5.1 Methodische Vorgehensweise;45 7.1.1;5.1.1 Fallauswahl, Feldzugang und sozialstrukturelle Merkmale der befragten Schülerinnen und Schüler;45 7.1.2;5.1.2 Erhebungsverfahren;47 7.2;5.2 Diskussion des Erhebungsdesigns;49 7.3;5.3 Vorgehen bei der Auswertung der Daten;50 7.3.1;5.3.1 Auswertung der Fragebögen;50 7.3.2;5.3.2 Auswertung der Aufsätze;51 7.4;5.4 Ergebnisse der Befragung;51 7.4.1;5.4.1 Exkurs über Glücksbringer;51 7.4.2;5.4.2 Ergebnisse der Fragebogenauswertung;56 8;6. Zusammenfassung der Ergebnisse der Erhebung und Konsequenzen für die pädagogische Umsetzung des Themas Glück;86 8.1;6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Erhebung;86 8.2;6.2 Schulische Konsequenzen aus den Ergebnissen;88 8.2.1;6.2.1 Zur Notwendigkeit einer Glücksförderung in der Schule;88 8.2.2;6.2.2 Bedeutung von Emotionen für Lernen und Leistung;89 8.2.3;6.2.3 Konsequenzen für die Lehrerbildung;91 8.3;6.3 Bildungsziele zum menschlichen Existenzial Glück;94 8.4;6.4 Das Thema Glück im Unterricht Philosophieren mit Kindern;96 9;7. Ausblick auf aktuelle
Entwicklungen;99 10;8. Literaturverzeichnis;100 11;9. Anhang;104