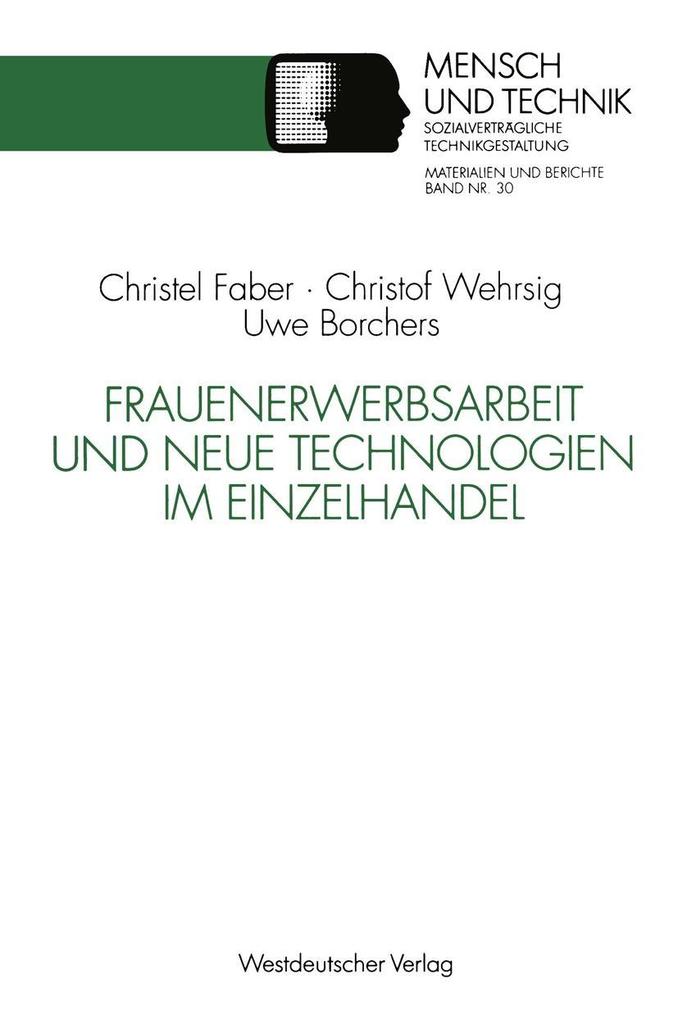
Sofort lieferbar (Download)
Der Einzelhandel ist traditionell eine Domäne der Frauenerwerbsarbeit. Er greift damit auf die spezifische soziale Konstruktion eines "weiblichen Arbeitsvermögens" zurück und orientiert daran die eigenen Personaleinsatzkonzepte, zugeschnitten auf ein fragmentiertes und begrenzt aufstiegsorientiertes Berufsleben. Die Untersuchung fragt nach dem Änderungspotential des Einsatzes von IuK-Technologien, vor allem von Warenwirtschaftssystemen, für diesen Grundtatbestand. Sie beantwortet diese Frage differenziert nach den Be- und Vertriebstypen (Warenhäuser, Kaufhäuser, Discounter), die unterschiedliche Rationalisierungsstrategien und Folgeprobleme aufweisen. Die Entwicklung scheint gespalten. Sie variiert zwischen einer Verfestigung "segmentierter Teilzeitarbeit" und der Eröffnung eines qualitativen Personalentwicklungsbedarfes. Der Fluchtpunkt dafür bleibt der kollektiv zu organisierende Tausch von "Flexibilität" gegen "betriebliche Anerkennung" des anderen weiblichen Arbeitsvermögens.
Inhaltsverzeichnis
Gliederung.- 1. Einleitung: Problemdifferenzierungen.- 1.1 Inkonsistenter Arbeitsmarktstatus und betriebliche Nutzung des weiblichen Arbeitsvermögens.- 1.2 Rationalisierungsstrategien und betriebliche Praktiken.- 1.3 Organisationen und Akteure.- 2. Anfragen an das Konzept Systemische Rationalisierung .- 2.1 Informatisierung: glatte Technisierung oder sperrige Systemrationalität.- 2.2 Transparenz: ein großes Kontroll , aber ein kleineres Steuerungspotential?.- 2.3 Personalisierung: die neue Bedeutung der alten Leistungsmoral?.- 3. Frauenerwerbsarbeit im Einzelhandel: Die Ressource Frau .- 3.1 Der defizitäre Erwerbsstatus Frau : Der Ausverkauf der Verkäuferinnen?.- 3.2 Betriebliche Nutzungskonzepte von weiblicher Arbeitskraft im Einzelhandel.- 3.3 Interessenvertretung: Die Wechselseitigkeit von Interessen?.- 4. Rationalisierungsprozesse in drei typischen Betriebsformen des Einzelhandels.- 4.1 Discounter: Warenwirtschaft pur?.- 4.2 Warenhäuser: Neue Sparten technisch integriert?.- 4.3 Kaufhäuser: Neue Technologien im Kulissenbereich?.- 5. Interessenvertretung: Neue Technologien und alte Politiken.- 5.1 Interessenvertretung im Betrieb.- 5.2 Frauen zwischen Beruf und Familie.- 5.3 Teilzeitarbeit und Qualifizierung.- 6. Ergebnisse: Neue Technologien und moralische Ökonomie der weiblichen Arbeitskraft im Einzelhandel.- 6.1 Informatisierung: Transparenz und Strategieïahigkeit.- 6.2 Organisationsstrukturen und Personaleinsatzeffekte.- 6.3 Personalpolitiken: Eine moralische Ökonomie mit dem weiblichen Arbeitsvermögen?.- Literatur.
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
13. März 2013
Sprache
deutsch
Auflage
1992
Seitenanzahl
166
Dateigröße
19,04 MB
Reihe
Sozialverträgliche Technikgestaltung, Materialien und Berichte
Autor/Autorin
Uwe Borchers, Christof Wehrsig
Co-Autor/Co-Autorin
Christel Faber
Verlag/Hersteller
Originalsprache
deutsch
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Produktart
EBOOK
Dateiformat
PDF
ISBN
9783322941954
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Frauenerwerbsarbeit und Neue Technologien im Einzelhandel" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.































