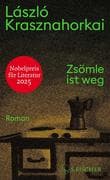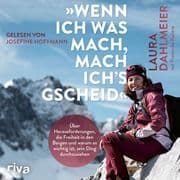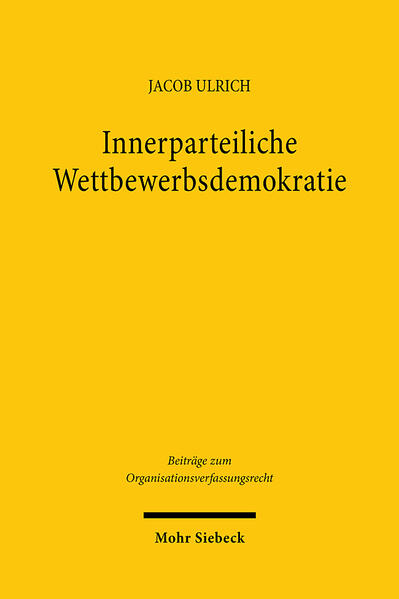Das Gebot innerparteilicher Demokratie will die Grundlage für einen freien und gleichen Wettbewerb in den politischen Parteien schaffen. Mithilfe rechtsökonomischer Methoden und einer eigenen empirischen Studie untersucht Jacob Ulrich, ob das Parteienrecht und die Satzungen der Parteien den verfassungsrechtlichen Vorgaben entsprechen.
Innerparteiliche Demokratie ist innerparteiliche Wettbewerbsdemokratie. Die grundgesetzliche Demokratie kann als System wettbewerblicher Interessenaggregation beschrieben werden. Art. 21 Abs. 1 S. 3 GG überführt diese wettbewerbliche Demokratiekonzeption in die Parteien; sie prägt deren Willensbildungsprozesse und will so die Grundlage für einen freien und gleichen innerparteilichen Wettbewerb schaffen. Aber gelingt das auch? Jacob Ulrich bestimmt zunächst den verfassungsrechtlichen Gehalt der innerparteilichen Wettbewerbsdemokratie. Mithilfe rechtsökonomischer Methoden und einer eigenen empirischen Studie zeigt er, inwiefern das Parteienrecht einerseits und die Binnenorganisation der im Bundestag vertretenen Parteien andererseits mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben vereinbar sind und an welchen Stellen Nachbesserungsbedarf besteht.
Inhaltsverzeichnis
Einführung
§ 1 Motivation und Forschungsfrage
§ 2 Untersuchungsgegenstände
§ 3 Methoden
§ 4 Analyseinstrumente: Einsichten der politischen Ökonomie
§ 5 Gang der Darstellung
Erster Teil: Wettbewerbsgrundlagen
§ 6 Leitbild
§ 7 Parteifunktionen
Zweiter Teil: Wettbewerbsordnung
§ 8 Ordnungsrahmen
§ 9 Ordnungsverpflichtete
§ 10 Wettbewerbshüter
Dritter Teil: Wettbewerbsanalyse
§ 11 Wettbewerbliche Anreizprobleme und Informationsasymmetrien
§ 12 Wettbewerbskonzentration
§ 13 Transaktionskosten
§ 14 Zusammenführung: Perpetuierung wettbewerblicher Demokratiehindernisse
Ausblick: Wettbewerbsreformen?
§ 15 Wettbewerbliche Anreizprobleme und Informationsasymmetrien abbauen
§ 16 Wettbewerbskonzentration aufbrechen
§ 17 Transaktionskosten verringern
§ 18 Zusammenführung: Verbesserung innerparteilicher Wettbewerbsdemokratie